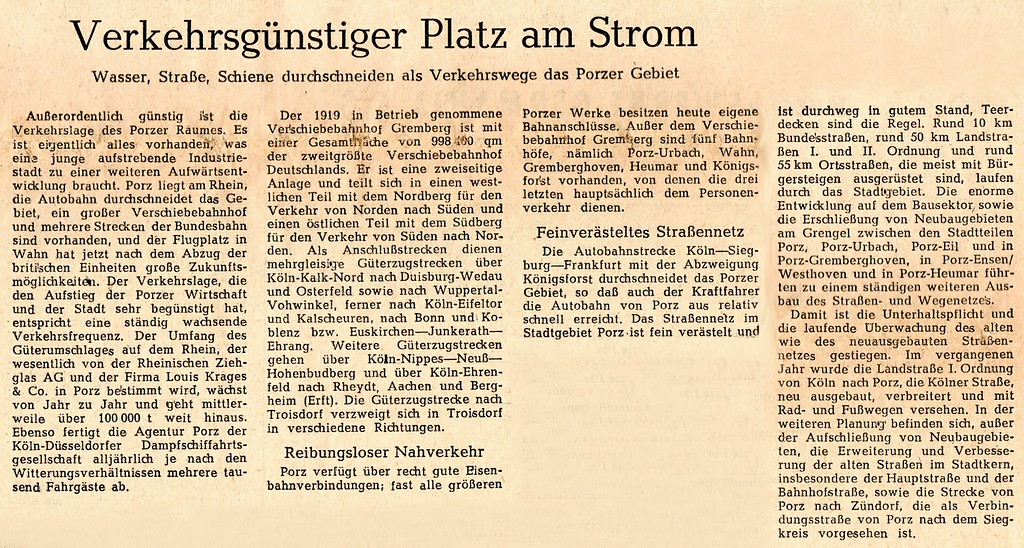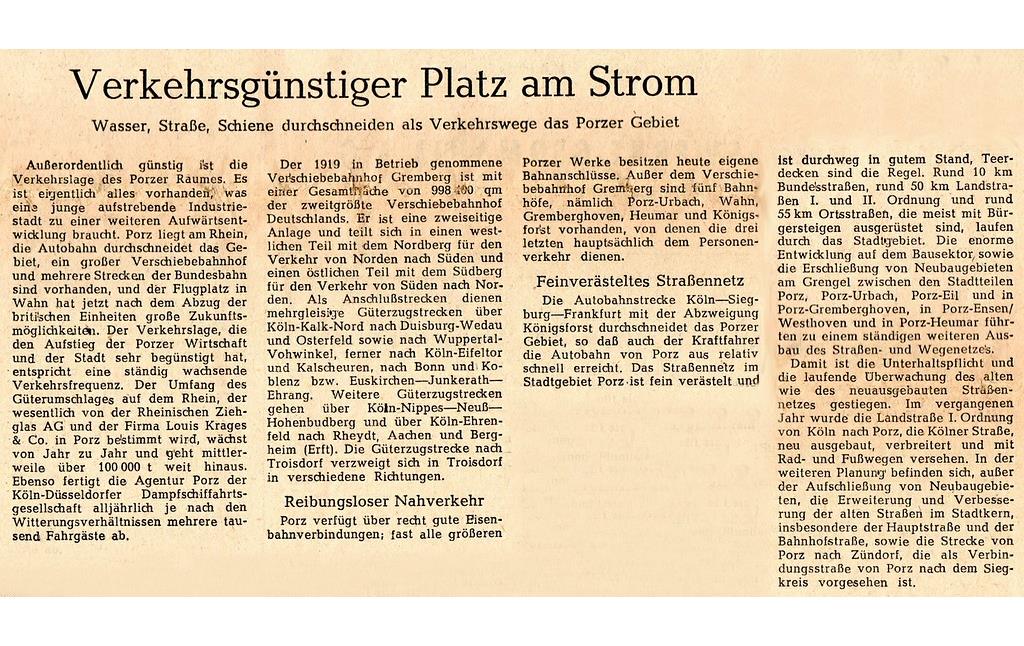Vorgeschichte bis 1861
Die Zeit bis 1945
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1991
S-Bahn Köln / Rheinland
Betriebsstellen
Hinweis, Quellen, Links, Literatur
Vorgeschichte bis 1861
Von Köln und Düsseldorf ausgehend waren Mitte des 19. Jahrhunderts mehrere Bahnverbindungen in Richtung Nordseehäfen und dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet gebaut worden (Düsseldorf-Elberfeld, Köln-Antwerpen, Köln-Mindener Bahn).
Im Siegerland lag das alte Erzabbaugebiet an Sieg, Lahn, Dill und Heller. Im frühen 19. Jahrhundert gab es hier über 40 Eisenhütten und etwa 200 Hammerwerke. Diese waren nur ungenügend an das vorhandene Straßennetz bzw. an schiffbare Flüsse angebunden. So gab es bereits 1833 erste Ideen zu einer Bahnverbindung von Antwerpen über Köln durch das Siegtal und weiter nach Kassel, Berlin und Stettin. Die Siegerländer Industrie war sehr am Bau einer Eisenbahn interessiert und förderte die Ideen und Planungen. Dies betraf die Anfuhr von Brennmaterialien, vorrangig von Kohlen und Koks aus dem Ruhrgebiet, dem Aachener Revier, aus Belgien und England. Da zugleich billigeres Roheisen aus England und Belgien auf den deutschen Markt drängte, war es dringend erforderlich, die Transportkosten für die Eisenprodukte zu minimieren. Die Hauptabnehmer für Siegerländer Roheisen lagen in der Grafschaft Mark und im Ruhrgebiet. Allerdings wurde die direkten Verbindung Richtung Ruhrgebiet wegen der schwierigen topographischen Verhältnisse erst später realisiert (1859-1861 von Siegen nach Hagen).
Zur Verbesserung der Erschließung für die Absatzmärkte war 1846 begonnen worden, eine Verbindung von Frankfurt am Main über Gießen nach Kassel zu bauen (Main-Weser-Bahn). Von Kassel aus waren die Industriegebiete in Mitteldeutschland (Halle, Leipzig), die preußische Hauptstadt Berlin und die Nordseehäfen im damaligen Königreich Hannover zu erreichen.
nach oben
Das Königreich Preußen hatte Interesse, eine Verbindung zwischen den Kohlevorkommen und Hüttenwerken im Ruhrgebiet und den Erzvorkommen im Siegerland herzustellen. Zudem besaß Preußen mit der Stadt Wetzlar eine Exklave mit ausgeprägter Industrie, die an die Eisenbahn und an das Kernland angeschlossen werden sollte. Der Anschluss an die Main-Weser-Bahn war in Gießen geplant.Es gab auch militärische Aspekte für den Bau der Strecke. Zum einen waren es die Erzvorkommen im Siegerland, die auch für das Militär und deren Munitions-Beschaffungen eine wichtige Rolle spielten. Zudem war die Bahnlinie für den Transport von Truppen und Material erforderlich, da sie an die erste Verbindung von Nordwestdeutschland nach Süddeutschland über die Main-Weser-Bahn angeschlossen war. Zusätzlich lag die Strecke in einiger Entfernung des damaligen Feindes Frankreich, so dass sie mehr den einheimischen Truppen als dem Feind gedient hätte.
Es wurde daher eine Eisenbahn durch das Siegtal nach Gießen geplant. Die Konzession für Bau und Betrieb der Siegstrecke erteilte die preußische Regierung am 26. Juli 1855. Da die Strecke durch das Herzogtum Nassau geführt werden sollte, wurde die Konzession zum Bau und Betrieb der Bahn auf dem Gebiet des Herzogtums 1860 erteilt.
Die Konzessionen für den Bau und Betrieb der Bahn erhielt die Cöln-Mindener Eisenbahn (CME). Der Bau begann in Deutz, im Anschluss an die 1859 fertig gestellte Rhein-Brücke. In Deutzerfeld errichtete man einen großen Rangier- und Abstellbahnhof einschließlich Betriebswerkstätte. Über diesen Bahnhof wurde die direkte Verbindung mit der Köln-Mindener Bahn und dem Ruhrgebiet hergestellt.
Trotz der schwierigen topographischen Verhältnisse im Mittelgebirge, die den Bau von zahlreichen Brücken und Tunneln erforderte, konnte der erste Abschnitt zwischen Deutz und Hennef am 1. Januar 1859 eröffnet werden. Die Fortführungen wurden bis Eitorf am 15. Oktober 1859, die bis Wissen am 1. August 1860 und weiter bis Betzdorf und Siegen am 10. Januar 1861 in Betrieb genommen. Die Verbindung bis Gießen wurde am 12. Januar 1865 eröffnet.
nach oben
Die Zeit bis 1945
Der Verkehr auf der Strecke entwickelte sich so gut, dass der zweigleisige Ausbau bis 1870 abgeschlossen werden konnte. Vor allem im Güterverkehr, aber auch als Umleitungsstrecke für den Rheinkorridor, wurde die Strecke genutzt. Im Güterverkehr waren es besonders die schweren Kohlenzüge und Erztransporte, die das Bild der Bahnstrecke bestimmten. Der Personenverkehr hatte eine geringere Bedeutung, 1865 bot man vier Personenzugpaare zwischen Deutz und Siegen an. Die Fahrzeit betrug 4 Stunden und 11 Minuten.
Betriebswerke hatte die CME in Köln-Deutzerfeld, Eitorf und Betzdorf errichtet. Zusätzlich gab es an mehreren Stationen Wasserkräne für die Versorgung der Dampflokomotiven. In Betzdorf richtete man einen größeren Rangierbahnhof ein, der 1893 erheblich erweitert wurde. Betzdorf war einer der betrieblichen Mittelpunkte der Strecke.
1874 wurde zwischen Troisdorf und Kalk parallel zur Siegstrecke die Bahnverbindung von Niederlahnstein bei Koblenz nach Mülheim a.d. Ruhr-Speldorf verlegt. Beide Strecken laufen bis heute parallel zueinander.
Die Cöln-Mindener Eisenbahn ging 1880 in preußischen Staatsbesitz über, die Betriebsführung auf der Strecke übernahmen die Preußischen Staatsbahnen (seit 1897 die Königlich Preußische und Großherzoglich Hessische Eisenbahnbetriebs- und Finanzgemeinschaft).
1909 gab es ein schweres Sieghochwasser, bei dem auch einige der Bahnbrücken zerstört wurden. Diese wurden anschließend wieder aufgebaut, teilweise mit eingleisigen Provisorien. Die Brücke in Herchen musste vollständig neu erbaut werden.
1914 waren im Fahrplan 14 Zugpaare ausgewiesen, davon zwei D-Züge und ein Eilzug. Hinzu kamen Züge auf Teilstrecken und Verbindungen mit Umstiegen in Troisdorf oder Au.
Vor und mit Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 wurden zahlreiche Truppen und Materialien aus dem Deutschen Reich an die Westfront in der Eifel gefahren. Ebenso nutze man die Strecke für Krankentransporte und die Rückkehr der Soldaten nach dem verlorenen Krieg 1918.
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Strecke massiv gestört. Nahezu alle Brücken und Tunnel wurden zerstört oder beschädigt, entweder durch alliierte Flieger oder deutsche Truppen auf dem Rückzug. Es gab 1945 keine durchgehenden Zugverbindungen mehr. Es wurde auf Teilstrecken gefahren, die dazwischen liegenden Abschnitte mussten zu Fuß überwunden werden.
nach oben
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1991
Wegen der hohen wirtschaftlichen und militärischen Bedeutung wurde der Streckenabschnitt von Troisdorf bis Köln in kurzer Zeit wieder hergestellt.
Die Siegstrecke war nach dem Ende des Krieges nicht mehr befahrbar. Hinzu kam die Einteilung in die Zonen der alliierten Besatzer. Das Rheinland bis Au gehörte zur britischen Zone, das angrenzende, damals zu Hessen-Nassau gehörende Gebiet zur französischen Zone. Wegen der Zonengrenze hatten die Alliierten kein Interesse an einem zügigen Wiederaufbau der Strecke.
In der Zeit nach dem Kriegsende wurden die Brücken wieder aufgebaut, teilweise zunächst mit provisorischen Lösungen. Auch die Tunnel wurden wieder befahrbar gemacht. Die Strecke wurde erst wieder 1947 durchgehend befahren.
Der zweigleisige Wiederaufbau begann erst 1949. Die Zweigleisigkeit wurde in Abschnitten zwischen 1952 und 1960 wieder in Betrieb genommen. Allerdings blieben zwei Abschnitte bei Blankenberg und Rosbach weiterhin eingleisig, weil die dortigen Brücken nur eingleisig befahrbar waren und sind.
In den 1950er Jahren wurden Personenzüge mit den neuen Schienenbussen der Baureihe VT 95 und VT 98 (795/798) eingeführt. In diesem Zusammenhang versuchte auch die Deutsche Bundesbahn, mehr Verkehr auf die Strecke zu bringen und richtete mehrere neue Haltepunkte ein (z.B. Opperzau, Kleehahn).
1970 bot die Deutsche Bahn zwischen Köln und Betzdorf 16 Zugpaare an, davon vier D-Züge mit weniger Zughalten. Hinzu kamen weitere Züge auf Teilstrecken.
Bis zum Ende der Dampflokomotiven 1976 waren die schweren Kohlenzüge und Schotterzüge auf der Siegstrecke prägend, die Züge hatten Gewichte bis 1.800 Tonnen. Später wurden Diesellokomotiven für diese Züge eingesetzt.
nach oben
Als erster Abschnitt wurde die Strecke von Troisdorf bis Köln 1962 elektrifiziert, als Teil der rechtsrheinischen Verbindung aus Südwestdeutschland. Ab 1978 wurde die Strecke ab Troisdorf elektrifiziert. Vor allem in den niedrigen Tunneln waren umfangreiche Arbeiten erforderlich. Den elektrischen Betrieb auf der Siegstrecke nahm man zum Fahrplanwechsel Mai 1980 auf. Bekannt war die Strecke auch für die sogenannten »Heckeneilzüge« von Frankfurt nach Köln. Es waren Eilzüge, die nicht entlang der Hauptstrecken, sondern gezielt auf den Nebenstrecken fuhren. Wie der Eilzug von Kall (Eifel) über Köln, Au, Altenkirchen, Limburg nach Frankfurt am Main, Fahrzeit im Sommer 1970: 5 Stunden und 47 Minuten.
Über die Strecke wurden auch belgische Sonderzüge gefahren. Es waren Züge für belgische Truppen die Trains de permissionaires journaliers (TPJ), die zwischen Siegen und Brüssel über die Siegstrecke verkehrten. Es war ein Militärschnellzugpaar, dass zwischen 1957 und 1982 verkehrte und nur für belgisches Militär zugelassen war. Die Züge bestanden aus mehreren deutschen D-Zug-Wagen. Bis zum Sommer 1975 wurden die Züge von Dampflokomotiven von Siegburg bis Siegen gefahren. Danach wurden Diesellokomotiven eingesetzt. Zwischen Brüssel und Aachen zogen belgische Gleichstromloks, von Aachen bis Troisdorf deutsche Wechselstromloks die Züge.
Ab den 1980er Jahren ging der Güterverkehr über die Strecke stark zurück, er wurde über die rechtsrheinische Strecke und die Main-Weser-Bahn abgewickelt. Den Fernverkehr stellte die Deutsche Bundesbahn ebenfalls in den 1980 Jahren ein.
2002 wurde die neue Schnellfahrstrecke von Köln bis Frankfurt am Main in Betrieb genommen. Zur Anbindung an das bestehende Netz waren umfangreiche Arbeiten erforderlich. Dazu gehören die neuen Gleise im Abzweig Köln Steinstraße und die Untertunnelung der Strecke im Bereich des Bahnhofes Troisdorf. Über diesen Tunnel wird die Siegstrecke an die rechtsrheinische Strecke nach Koblenz angebunden. Bis Siegburg verlaufen die Strecken nach Betzdorf und Frankfurt parallel zueinander.
2004 kam der Anschluss des Flughafens Köln/Bonn an die Schnellstrecke und die S-Bahn-Strecke hinzu. Die Flughafenschleife verläuft zwischen dem Abzweig Flughafen Nordwest und Porz-Wahn Süd.
Aktuell ist die Strecke in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen worden. Ziel ist der vollständige zweigleisige Ausbau zwischen Hennef und Au und die Herstellung eines größeren Profils in allen Tunneln. Dies gehört zum Korridor Mittelrhein, womit auch eine Erhöhung des Güterverkehrs über die Strecke verbunden ist.
nach oben
S-Bahn Köln / Rheinland
Im Juni 1975 war eine erste S-Bahn-Linie in Köln eröffnet worden, die S 11 zwischen Bergisch Gladbach und Köln-Chorweiler. Für die S-Bahn wurde in Köln die Stammstrecke, die neue Trasse zwischen Köln-Hansaring über den Hauptbahnhof nach Köln-Deutz, 1990 in Betrieb genommen. Im folgenden Jahr 1991 wurde die neue S 12 eingeführt, die zunächst im Vorlaufbetrieb von Köln über Troisdorf nach Hennef und weiter nach Au fuhr. Von dort fuhren die konventionellen Züge weiter als Nahverkehrszug bis Siegen.
Für die S-Bahn wurden 1991 zur Entflechtung von S-Bahn und überregionalem Verkehr zwischen der Stammstrecke und dem Abzweig Vingst neue Gleise verlegt, um einen unabhängigen Verkehr zu ermöglichen. Zugleich wurde eine neue Zufahrt mit Brücke von der Siegstrecke an die S-Bahnsteige im Deutzer Bahnhof errichtet. Diese separaten S-Bahn-Gleise verlängerte man 2003 bis zum Abzweig Köln Steinstraße.
Ab Mai 2000 fuhren auf der Strecke bis Au die neuen Triebwagen der Baureihe 423. 2003 baute man die Strecke im Siegtal für die alleinige Nutzung mit S-Bahn-Triebwagen aus: vor allem wurden neue, erhöhte Bahnsteige angelegt.
2004 wurde die Flughafenschleife in Betrieb genommen. Die S 12 wurde zur vollgültigen S-Bahn, die Halte Airport-Businesspark und Steinstraße neu angelegt. Hinzu kam die S 13 bis Troisdorf.
Aktuell wird die Strecke zwischen Köln und Betzdorf durchgehend vom Regionalexpress RE 9 (Rhein-Sieg-Express Aachen – Siegen) bedient. Zwischen Au und Betzdorf verkehrt die Regionalbahn RB 90 (Westerwald-Sieg-Bahn Siegen – Limburg). Die Kölner S-Bahn-Linien S 12 (Au – Horrem) und S 19 (Au – Düren) befahren die Strecke bis Au.
nach oben
Betriebsstellen
Die Strecke weist eine Länge von rund 83 Kilometern auf. Die Streckenkilometrierung beginnt in Köln-Deutz.
(Bf = Bahnhof, Hp = Haltepunkt, S-Bf = Bahnhof der S-Bahn Rhein-Sieg, Abzw = Abzweig; jeweils aktuelle bzw. letzte Bezeichnung)
Bahnkilometer | Name |
0,0 | Bf Köln Messe/Deutz (seit 1845, seit 1990 S-Bf; Verbindungen zum Kölner Hauptbahnhof, nach Düsseldorf) |
1,9 | S-Bf Köln Trimbornstraße (seit 1991) |
2,4 | Bf Köln-Kalk (1886-1991 Personenverkehr, verlegt; Verbindungen nach Köln-Süd und Köln-Mülheim) |
3,9 | Abzw Vingst (Verbindung nach Köln-Mülheim) |
4,4 | Abzw Flughafen Nordost (Verbindungen nach Overath und zum Flughafen Köln-Bonn) |
6,1 | S-Bf Köln Airport-Businesspark (seit 2004) |
7,2 | Hp Porz-Gremberghoven (1917-2003 Personenverkehr, seit 1991 S-Bf, verlegt) |
7,8 | Abzw Köln Steinstraße (Verbindungen nach Mülheim a.d. Ruhr-Speldorf und zur Rhein-Main Schnellstrecke) |
8,0 | S-Bf Köln-Steinstraße (seit 2004) |
9,6 | S-Bf Porz (Rhein) (1874-1966 Bf Urbach/Porz-Urbach, seit 1991 S-Bf) |
12,4 | Bf Porz-Wahn (1859-1966 Wahn/Wahn (Rheinland), seit 1991 S-Bf; Verbindung zum Flughafen Köln-Bonn, Anschluss zum Schießplatz Wahn; Übergang zur Wahner Straßenbahn) |
16,9 | S-Bf Spich (seit 1905 Hp, seit 1991 S-Bf) |
19,7 | Bf Troisdorf (seit 1991 S-Bf; Verbindung nach Koblenz, Übergang zur Kleinbahn Siegburg - Zündorf, Anschluss Dynamit Nobel AG) |
24,3 | Bf Siegburg/Bonn (1859-2002 Bf Siegburg, seit 1991 S-Bf; Verbindung nach Overath, zur Friedrich-Wilhelmshütte, Übergang zur Bröltalbahn, zur U-Bahn nach Bonn, zur Kleinbahn Siegburg - Zündorf) |
– | S-Bf St. Augustin-Buisdorf (geplant) |
30,8 | Bf Hennef (Sieg) (seit 1991 S-Bf; Verbindung zur Bröltalbahn) |
32,7 | S-Bf Hennef Im Siegbogen (seit 2011) |
35,2 | Bf Blankenberg (Sieg) (seit 1991 S-Bf) |
38,4 | Hp Merten (1897-1905 Bf Merten, seit 1991 S-Bf) |
– | Tunnel Merten (235 Meter) |
43,0 | Bf Eitorf (seit 1991 S-Bf) |
– | Anschluss Boge & Sohn KG in Eitorf |
49,9 | Bf Herchen (seit 1991 S-Bf) |
– | Tunnel Herchen (370 Meter) |
– | Hoppengarten-Tunnel (130 Meter) |
54,9 | Hp Dattenfeld (Sieg) (seit 1880, seit 1991 S-Bf) |
58,3 | Bf Schladern (Sieg) (seit 1991 S-Bf) |
– | Tunnel Mauel (238 Meter) |
60,1 | Hp Rosbach (Sieg) (seit 1880, seit 1991 S-Bf) |
64,8 | Bf Au (Sieg) (seit 1991 S-Bf; Verbindung Engers) |
66,5 | Hp Opperzau (1954-1994 Personenverkehr) |
67,3 | Hp Etzbach |
71,3 | Bf Wissen |
– | Schönsteiner Tunnel (344 Meter) |
... | Hp Kleehahn (1953-1986) |
75,3 | Hp Niederhövels (Personenverkehr ab 1883) |
– | Staader Tunnel (224 Meter) |
– | Mühlburgtunnel (32 Meter) |
79,7 | Hp Scheuerfeld (Sieg) |
83,0 | Bf Betzdorf (Verbindungen nach Siegen, Limburg (Lahn), Bad Berleburg, Daaden) |
nach oben
(Claus Weber, Redaktion KuLaDig, 2015, 2025)
Hinweis
Die Eisenbahnstrecke von Köln-Deutz nach Betzdorf ist wertgebendes Merkmal des Kulturlandschaftsbereichs „Köln-Siegen-Gießener Eisenbahn“ (Regionalplan Köln 360).
Quellen
Donni, Betzdorfer Dampfbetrieb 68-76; Teil 4: Dampfzüge an der Sieg I (13 Bilder) (online www.drehscheibe-online.de und Betzdorfer Dampfbetrieb 68-76; Teil 13: Dampfzüge an der Sieg II (13 Bilder) (online www.drehscheibe-online.de, abgerufen 25.6.2025)
Günter Tscharn, Um 1990 zwischen Troisdorf und Betzdorf (Siegstrecke, 21 Bilder vor Einführung der S-Bahn) (online www.drehscheibe-online.de, abgerufen 25.6.2025)
Internet
de.wikipedia.org: Siegstrecke (abgerufen 24.6.2025)
de.wikipedia.org: Bahnstrecke Deutz – Gießen (abgerufen 24.6.2025)
www.siegerlandbahn.de: Die Siegtal-Bahn von Köln (Deutz) nach Siegen (abgerufen 24.6.2025)
eisenbahntunnel-portal.de: Lothar Brill, Strecke 2651 (abgerufen 24.6.2025)
stellwerke.info: Stellwerke an der Strecke 2651 (abgerufen 24.6.2025)