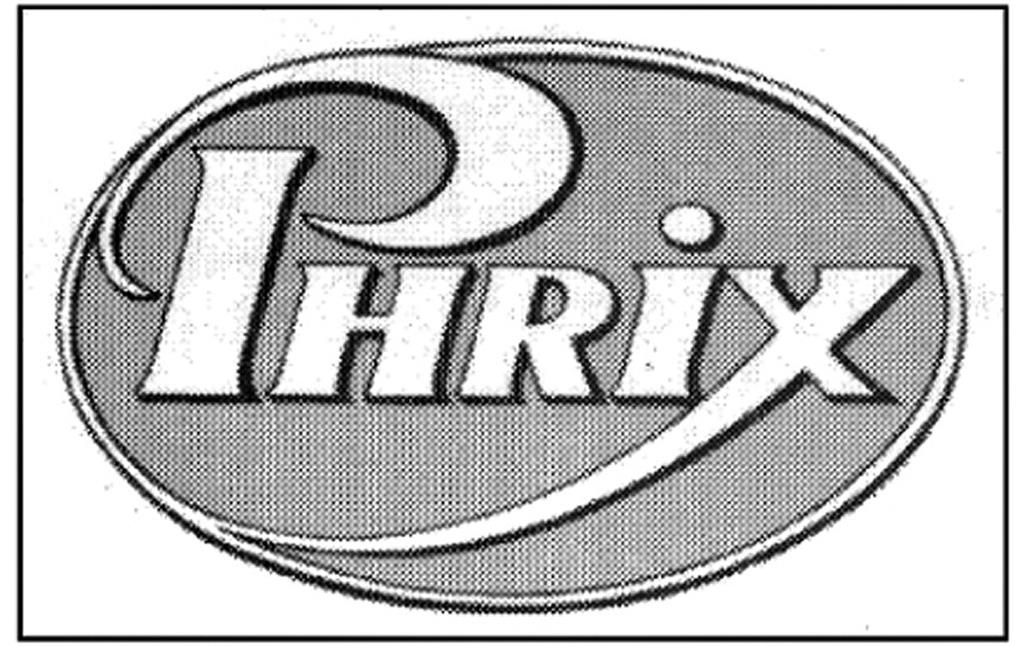Zellwolle-Werke Phrix der Rheinischen Zellwolle AG
ehemalige Fabrik der J. P. Bemberg AG, heute Gewerbegebiet und TurmCenter
Schlagwörter:
Fachsicht(en): Kulturlandschaftspflege, Landeskunde
Gemeinde(n): Siegburg
Kreis(e): Rhein-Sieg-Kreis
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Koordinate WGS84 50° 47′ 25,5″ N: 7° 13′ 26,38″ O 50,79042°N: 7,22399°O
Koordinate UTM 32.374.821,75 m: 5.628.022,25 m
Koordinate Gauss/Krüger 2.586.350,21 m: 5.629.045,98 m
-
Der markante Turm im Süden des früheren Zentralgebäudes der ehemaligen Zellwolle-Werke "Phrix" der Rheinischen Zellwolle AG in Siegburg (2016).
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
-
Blick vom Buisdorfer Siegwehr aus auf den oberen Teil des 55 Meter hohen Turms der früheren Zellwolle-Werke "Phrix" der Rheinischen Zellwolle AG in Siegburg (2016). Zu erkennen sind die Uhr und verschiedene Sende- und Empfangsanlagen auf dem Dach.
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
-
Das zentrale Werksgebäude und der markante Turm der Zellwolle-Werke "Phrix" der Rheinischen Zellwolle AG, heute als modernes Gewerbegebiet erschlossen (2016).
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
-
Jüngere Gewerbebetriebe im früheren Zentralgebäude der Zellwolle-Werke "Phrix" der Rheinischen Zellwolle AG (2016).
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
-
Das zentrale Werksgebäude und der markante Turm der Zellwolle-Werke "Phrix" der Rheinischen Zellwolle AG, heute als modernes Gewerbegebiet erschlossen (2016).
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
-
Inzwischen wieder genutzte Bereiche im südlichen Teil des ehemals zentralen Phrix-Werksgebäudes mit einer Grundfläche von etwa 225 x 90 Metern im heutigen Gewerbegebiet "Am Turm" in Siegburg (2016).
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
-
Das Firmenlogo der Siegburger Zellwolle-Werke "Phrix" der Rheinischen Zellwolle AG (um 1936/37).
- Copyright-Hinweis:
- Urheber unbekannt
- Medientyp:
- Bild
-
Noch nicht wieder genutzte Bereiche des ehemals zentralen Phrix-Werksgebäudes mit einer Grundfläche von etwa 225 x 90 Metern im heutigen Gewerbegebiet "Am Turm" in Siegburg (2016).
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
-
Der Turm der früheren Phrix-Werke in Siegburg, Ansicht von der Wahnbachtalstraße aus (2017).
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
-
Blick über das Buisdorfer Siegwehr in Richtung Siegburg auf den 55 Meter hohen Turm der früheren Zellwolle-Werke "Phrix" der Rheinischen Zellwolle AG (2016).
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
-
Das zentrale Werksgebäude und der markante, 55 Meter hohe Turm der früheren Zellwolle-Werke "Phrix" der Rheinischen Zellwolle AG in Siegburg; heute als modernes Gewerbegebiet erschlossen (2016).
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
-
Betriebe im heutigen Gewerbegebiet "Am Turm" rund um die früheren Zellwolle-Werke "Phrix" der Rheinischen Zellwolle AG (2016).
- Copyright-Hinweis:
- Knöchel, Franz-Josef / CC-BY-NC-SA 3.0
- Fotograf/Urheber:
- Franz-Josef Knöchel
- Medientyp:
- Bild
Weimarer Zeit: Von der Bemberg AG zur Rheinischen Zellwolle AG
Zeit des Nationalsozialismus: Die Phrix-Werke Arbeitsgemeinschaft
Nachkriegszeit bis zur Werksschließung 1971
Heutige Situation
Der Phrix-Turm
Internet, Literatur
Weimarer Zeit: Von der Bemberg AG zur Rheinischen Zellwolle AG
Die Stadt Siegburg, die in den Jahren nach 1871 durch zwei entstandene Munitionsfabriken zur Industriestadt wurde, litt nach der Umstellung auf die Friedensproduktion nach dem Ersten Weltkrieg besonders. In den wirtschaftlichen Krisen der Weimarer Republik wurde Siegburg zur Stadt mit den meisten Arbeitslosen in Preußen (HbHistSt NRW 2006, S. 958).
In diesen Notzeiten plante die Stadt zusammen mit dem traditionsreichen Wuppertaler Textilunternehmen J. P. Bemberg Aktiengesellschaft die Ansiedlung eines Werks zur Herstellung von Kunstseide, bei dem 1.600 Menschen Arbeit finden sollten und das der Stadt wirtschaftlichen Aufschwung bringen sollte: „Um dieses neue, feine Gespinst zu erzeugen, musste Zellulose auf Basis von Holz entsprechend be- und verarbeitet werden. … Im Herbst 1929 waren die Werksgebäude zwar fertig gestellt, doch zu dem erwarteten Produktionsbeginn kam es nicht. … Die einsetzende Weltwirtschaftskrise ließ das hoffnungsvolle Projekt, noch bevor es begonnen hatte, scheitern.“ (siegburg.de).
Als Gelände für das Werk dienten die nördlich einer Siegschleife gelegenen Flächen, die auf den historischen Karten der Preußischen Uraufnahme (1836-1850) zwischen „auf dem Siegfeld“ und „auf dem alten Deich“ noch unbebaut zu erkennen sind. Die Preußische Neuaufnahme (1891-1912) weist östlich davon ein „Pumpwerk“ aus (vgl. die entsprechenden Kartenansichten).
Bis 1936 ragte der markante viereckige Turm mit seinen 55 Metern Höhe daher funktionslos in den Himmel, da das Werk von der Bemberg AG nie in Betrieb genommen wurde. In diesem Jahr kaufte die Rheinische Zellwolle AG das verlassene, in Siegburg bereits „die Bemberg“ genannte Gelände für 1,43 Millionen Reichsmark: „Man versprach sich durch die Herstellung der leichten Kunstseide eine gewisse Unabhängigkeit von teuren Importen. Doch ließen sich aus dieser Kunstseide hervorragend Fallschirme herstellen.“ (siegburg.de).
Zeit des Nationalsozialismus: Die Phrix-Werke Arbeitsgemeinschaft
Um den im NS-Reich als „kriegswichtig“ eingestuften Sektor der Zellstoffindustrie zu kontrollieren und in diesem eine enge Zusammenarbeit und Forschung zu gewährleisten, wurden in den Jahren 1940/1941 eine Reihe führender Zellstoffunternehmen zu dem Dachkonzern Phrix-Werke Arbeitsgemeinschaft mit Sitz in Hamburg vereint. Die von der Schlesischen Zellwolle AG in Hirschberg geleitete Phrix-Arbeitsgemeinschaft wurde bereits am 28. September 1939 gegründet (so de.wikipedia.org; nach Abelshauser 2003 erfolgte die Phrix-Gründung bereits 1938). Neben der Schlesischen Zellwolle AG und der Siegburger Rheinischen Zellwolle AG gehörten dem reichsweiten Werks-Zusammenschluss noch die Krefelder Rheinische Kunstseide AG (ab 1935/36), die Wittenberger Kurmärkische Zellwolle und Zellulose AG, die Küstriner Zellwolle und Zellulose AG (ab 1939) und weitere kleinere Unternehmen an.
Durch die 1940 erfolgte Inbetriebnahme einer weiteren Spinnstraße im Siegburger Werk erhöhte sich die Tagesproduktion von zuvor 30 auf nunmehr 40 Tonnen. Produziert wurde bis Dezember 1944, bevor der Betrieb zum Kriegsende eingestellt wurde.
Während des Zweiten Weltkriegs arbeiteten im Siegburger Phrix-Werk mehr als 3.000 Zwangsarbeiter, die aus dem Siegburger Zuchthaus und Strafgefängnis rekrutiert wurden, das auch als Straflager für Zwangsarbeiter-Außenkommandos für damals kriegswichtige Betriebe wie die Troisdorfer Dynamit AG und die Rheinische Zellwolle AG diente (Kraus 1999, S. 78ff.): „Beide Kommandos galten als Strafkommandos wegen ihrer Gesundheitsschädlichkeit und der besonderen Arbeitsbedingungen.“
Nachkriegszeit bis zur Werksschließung 1971
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der Betrieb erst im September 1948 wieder aufgenommen werden. Bei einem großen Brand am 4. Juni 1950, dem Dreifaltigkeitssonntag, brannte die so genannte „100-Meter Halle“ mit sämtlichen Wollevorräten vollständig nieder.
Am 1. Mai 1951 wurde die von dem Bildhauer Karl-Heinz Goedtke (1915-1995) als Sinnbild des Textilwerkes geschaffene 'Phrix-Plastik' im Rahmen einer Betriebsfeier vom Leiter des Konzerns Dr. Richard-Eugen Dörr (1896-1975) feierlich enthüllt. Sie stellt einen auf einem Widder reitenden Jüngling dar. Der Generaldirektor „enthüllte die Plastik und wies auf die Bedeutung des Wortes Phrix hin, das schon in Ovids 'Metamorphosen' zu finden sei und in der griechischen Literatur im Sinne von zartem Gekräusel mit seidiger Schmiegsamkeit gebraucht wurde.“
Nur wenige Jahre später machte der Phrix-Konzern dann bundesweit negative – und teils auch skurrile – Schlagzeilen: Es ging um Veruntreuungen, bei denen Vermögenswerte in Millionenhöhe ins Ausland geschafft worden sein sollen. Auf mysteriöse Weise verschwunden waren dabei unter anderem zur Herstellung von Zellwolle unentbehrliche Düsen aus Gold und Platin, die aus ostdeutschen Werken gerettet in einem Luftschutzbunker aufbewahrt wurden. Die mehrere hunderttausend Mark teuren Düsen konnten selbst unter Hinzuziehung einer Hellseherin nicht wieder aufgespürt werden (spiegel.de, 1953).
In der Folge fand mit dem „Dörr-Prozess“ vor dem Landgericht Hamburg von 1957 bis 1960 einer der längsten deutschen Wirtschaftsprozesse statt. Richard-Eugen Dörr saß nun wegen Untreue, Devisenvergehen und Betrug auf der Anklagebank und es hieß von ihm, dass er „absoluter Diktator [war], der seine Herrschaft innerhalb des Konzerns bis an die Grenzen des Möglichen ausdehnte. Widerspruch gegen seine Anordnungen oder Kritik an seinen Maßnahmen duldete er nicht.“ (spiegel.de, 1960).
Über die Produktionsprozesse und auch über zahlreiche Innovationen in diesen Jahrzehnten, die den Standort Siegburg sichern sollten, berichtet Alois Richarz in „Die Zellwolle in Siegburg“ ausführlich. So wurde in Siegburg eine eigene Forschungsabteilung mit Versuchsanlage installiert und die Herstellung von „Zellglas“-Folien in einer eigens gebauten Produktionsstraße aufgenommen (später als 'Zellophan' bekannt, der Siegburger Phrix-Handelsname lautete 'Phriphan'). Später kam noch die Herstellung von Polyäthylenfolie hinzu.
Die Mehrheit der Aktien der seit längerem schon kriselnden Phrix wurde 1967 durch den Ludwigshafener Chemiekonzern BASF (Badische Anilin- & Soda-Fabrik AG) übernommen (Abelshauser 2003 und siegburg.de). Nur vier Jahre später wurde die Produktion in Siegburg nach den Betriebsferien im Sommer 1971 eingestellt und das Werk stillgelegt. Ein Großteil der Fabrikgebäude wurde später abgerissen und die Maschinen verkauft oder verschrottet.
Etwa 1.650 Mitarbeiter wurden 1971 entlassen. Dass 1967 in Siegburg mit damals rund 34.000 Einwohnern mehr als 9.000 Menschen in Industriebetrieben tätig waren, verdeutlicht das dramatische Ausmaß der Phrix-Werksschließung.
Für den Gewässer- und Fischschutz an der Sieg kam hingegen mit der Werksschließung „die Wende zum Guten“, waren doch zuvor zahlreiche massenhafte Fischsterben auf die dauerhafte Wasserverschmutzung durch die Fabrik zurückzuführen. Bald konnten vor Ort wieder „stark gefährdete Arten wie Äsche, Bachforelle, Bachschmerle, Barbe, Gründling und Nase“ beobachtet werden (Linden / Weisser 2010).
Wenig später kehrte sogar der hier fast vollständig verschwundene Atlantische Lachs (Salmo salar) in die über den Mühlengraben mit dem Phrix-Gelände verbundene Sieg zurück.
Heutige Situation
Dass die bei der Produktion von Zellwolle entstandenen Abfallstoffe über Jahrzehnte hinweg nicht fachgerecht entsorgt worden waren, zeigte sich erst später: „Die Altlasten mussten in mehreren Tätigkeitsstufen beseitigt werden. Diese sehr aufwändigen Maßnahmen konnten erst 1997 beendet werden.“ (siegburg.de).
Rund um das zentrale Phrix-Backsteingebäude mit seiner Grundfläche von etwa 225 x 90 Metern hat sich auf dem ehemaligen Werksgelände inzwischen ein Gewerbepark entwickelt „mit einem bunten Gemisch an Sport- und Freizeitanlagen, Diskotheken, Handwerksbetrieben, Supermarkt etc. bis hin zu einer Internetfirma“ (ebd.).
Nach mehreren gewaltsamen Vorfällen rund um die Diskothek „Klangfabrik im Turm“, die im Sommer 2022 in einem tödlichen Messerangriff ihren traurigen Höhepunkt fanden, entschloss sich der Betreiber, diese für immer zu schließen. Auch in Zukunft soll auf dem ehemaligen Phrix-Gelände keine neue Diskothek mehr eröffnet werden (ga.de).
Der Phrix-Turm
Der 55 Meter hohe viereckige Turm des Werks ist stehen geblieben. Der Phrix-Turm – bei turmcenter.de auch als „Hochhaus“ bezeichnet – hatte mehrere Funktionen: Die großen Mengen Wasser, die für die Zellwolle-Produktion benötigt wurden, wurden über ein eigenes Wasserwerk aus Brunnen und dem nahgelegenen Fluss Sieg bezogen. Das Wasser wurde in den fünften Stock des Gebäudes in einen Behälter gepumpt, der ein Fassungsvermögen von 1.000 Kubikmetern hatte. Höhe und Gewicht gewährleisteten den für die Produktionsanlagen notwendigen Druck in den Wasserleitungen.
Die Bauform des Turms diente aber auch verschiedenen Fertigungsprozessen mit u.a. Tauchstationen und Zersetzungsbecken für die Zellstoffballen oder speziellen Presswerken, aus denen die gelöste Zellulose eine Etage tiefer in Behälter fiel (turmcenter.de). Nicht zuletzt diente das Gebäude als Fassade für eine großflächige Leuchtreklame der Phrix-Werke, als Uhrenturm (dies tut er bis heute) und das Dach als hochgelegener Standort für verschiedene Sende- und Empfangsanlagen.
Seit 2005 hat sich ein ganz besonderes Stück Natur im Phrix-Turm breit gemacht: Regelmäßig nisten und brüten in ihm Wanderfalken. Der Bestand von falco peregrinus war in den 1960ern infolge von Pestizidbelastung sowie Bejagung und illegaler Verfolgung dramatisch zurückgegangen. Inzwischen kommt der Wanderfalke als Brutvogel aber wieder in allen Landesteilen Nordrhein-Westfalens vor.
(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2016/2023)
Internet
www.turmcenter.de: Die Phrix-Werke (abgerufen 26.06.2018)
de.wikipedia.org: Phrix-Arbeitsgemeinschaft (abgerufen 27.06.2016)
de.wikipedia.org: Richard-Eugen Dörr (abgerufen 27.06.2016)
www.spiegel.de: „PHRIX-Konzern, Die Hellseherin befragt“ (Der Spiegel 36/1953 vom 02.09.1953, S. 10-12, abgerufen 27.06.2016)
www.spiegel.de: „Dörr-Prozess, Schweizer Touren“ (Der Spiegel 8/1960 vom 17.02.1960, S. 20-21, abgerufen 27.06.2016)
nrw.nabu.de: Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz des NABU NRW (abgerufen 27.06.2016)
ga.de: Diskothek in Siegburg, Die Klangfabrik schließt nach tödlicher Messerstecherei für immer (Text Andrea Ziech, General-Anzeiger vom 10.08.2022, abgerufen 10.08.2022)
www.siegburg.de: Das Phrix-Gelände (abgerufen 27.06.2016, Inhalt nicht mehr verfügbar 18.08.2021)
www.turmcenter.de: Phrix-Werk Siegburg (= Alois Richarz, „Die Zellwolle in Siegburg“, vgl. auch Literatur) (abgerufen 27.06.2016, Inhalt nicht mehr verfügbar 26.06.2018)
www.phrix-siegburg.de: Nachtclub Phrix in Siegburg – Club, Bar, Lounge (abgerufen 27.06.2016, Inhalt nicht mehr verfügbar 26.06.2018)
Literatur
- Abelshauser, Werner (2003)
- Die BASF, eine Unternehmensgeschichte. München (2. Auflage).
- Bernert, Holger (2017)
- Aus ungenutzt wird umgenutzt. Neuer Zweck für alte Bonner Bauten. In: meinRHEINLAND 01/2017, S. 54-59. S. 58, o. O.
- Groten, Manfred; Johanek, Peter; Reininghaus, Wilfried; Wensky, Margret / Landschaftsverband Rheinland; Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Hrsg.) (2006)
- Handbuch der Historischen Stätten Nordrhein-Westfalen. (3. völlig neu bearbeitete Auflage). (HbHistSt NRW, Kröners Taschenausgabe, Band 273.) S. 955-959, Stuttgart.
- Kraus, Stefan (1999)
- NS-Unrechtsstätten in Nordrhein-Westfalen. Ein Forschungsbeitrag zum System der Gewaltherrschaft 1933-1945, Lager und Deportationsstätten. (Schriften zur Bodendenkmalpflege in Nordrhein-Westfalen 4.) Essen.
- Linden, Hubert; Weisser, Klaus / Fischschutzverein Siegburg 1910 e.V. (Hrsg.) (2010)
- 100 Jahre Fischschutzverein Siegburg 1910 e.V. - 1910-2010. S. 54, o. O.
- Stadtarchiv Sankt Augustin (Hrsg.) (2001)
- Fundgrube Vergangenheit. Aufsätze zur Stadtgeschichte. (Beiträge zur Stadtgeschichte, Heft 36.) S. 67ff., Siegburg.
Zellwolle-Werke Phrix der Rheinischen Zellwolle AG
- Schlagwörter
- Straße / Hausnummer
- Am Turm
- Ort
- 53721 Siegburg - Deichhaus
- Fachsicht(en)
- Kulturlandschaftspflege, Landeskunde
- Erfassungsmaßstab
- i.d.R. 1:5.000 (größer als 1:20.000)
- Erfassungsmethode
- Literaturauswertung, Geländebegehung/-kartierung, mündliche Hinweise Ortsansässiger, Ortskundiger, Auswertung historischer Karten
- Historischer Zeitraum
- Beginn 1929, Ende 1971
Empfohlene Zitierweise
- Urheberrechtlicher Hinweis
- Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY 4.0 (Namensnennung). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.
- Empfohlene Zitierweise
- „Zellwolle-Werke Phrix der Rheinischen Zellwolle AG”. In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-252442 (Abgerufen: 26. Februar 2026)