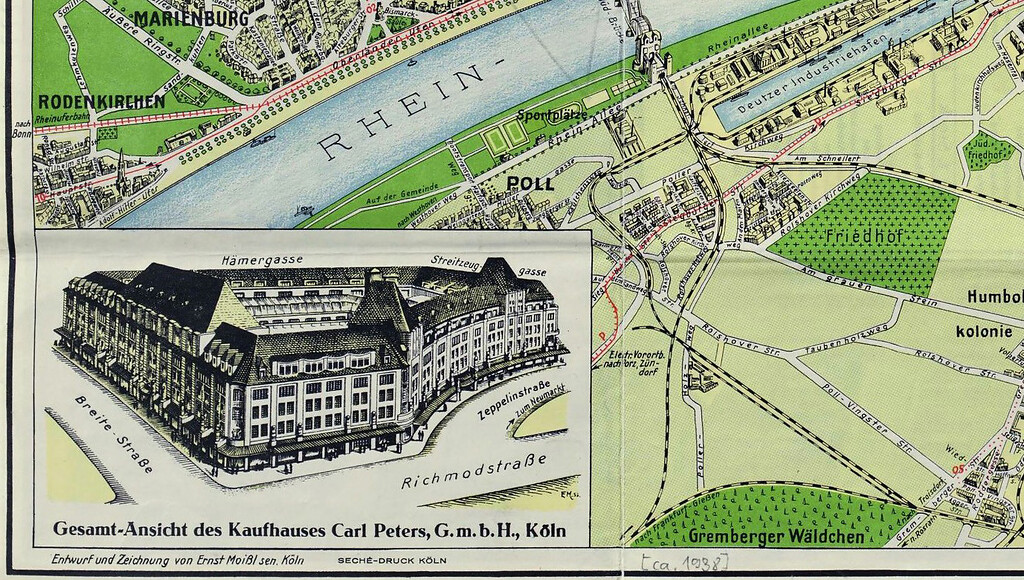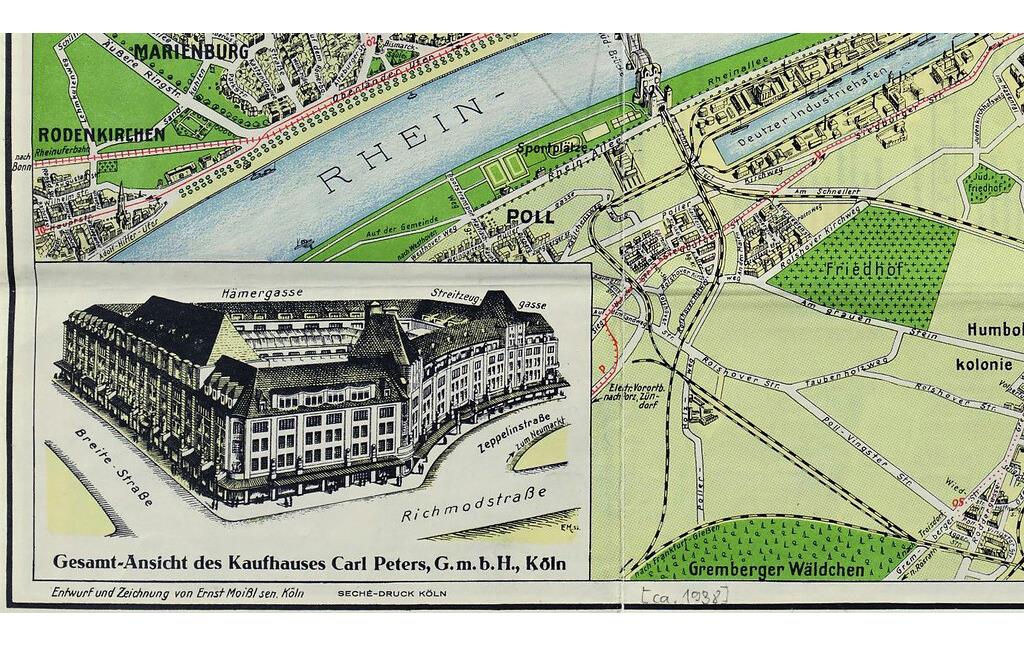Das 1090 Meter lange und 88 Meter breite Hafenbecken gliedert sich in einen Vorhafen nördlich der Drehbrücke und einen Haupthafen südlich davon. An beiden Hafenbecken sind die äußerst solide aus Basaltlavaköpfen gemauerten Uferbefestigungen, die zugleich als Kaimauern dienen, und die Sacktreppen und Poller aus der Bauzeit erhalten. Im Haupt- und Industriehafen stehen noch drei schwere Kräne von 1963 bzw. 1980 sowie Verladebrücken von 1983 und 1985.
Die Gleise der Hafenbahn führen an den Hafenbecken entlang, vereinigen sich im Süden am Durchlass durch den Bahndamm der Südbrücke und laufen dann weiter zum Verschiebebahnhof Poll. Hinter dem Damm liegt der als Denkmal eingetragene originale Lokschuppen der Hafenbahn mit kölnischem Wappen.
Außergewöhnlich kunstvoll gestaltet ist die 1907–08 erbaute Drehbrücke, die über das Hafenbecken hinweg zur Rheinuferstraße und den Poller Wiesen führt: Die Träger der elektrisch betriebenen, ungleicharmigen Stahlfachwerkbrücke fallen zu den Enden in elegantem Schwung ab. Bedient wird sie von einem kleinen, über dem Drehpunkt angeordneten Häuschen aus. Die Brücke mit einem Gewicht von 177 Tonnen wird mittels Hydraulik angehoben und durch einen Elektromotor gedreht. Die ornamental verzierten Blechplatten des Führerhäuschens, die großen, laternenbekrönten Pfeiler an den Brückenzufahrten und die Bleche in den Brüstungsgittern sind in Formen eines geometrisch interpretierten Jugendstils gehalten. Hersteller waren die Firmen Harkort (Duisburg) und Haniel & Lueg (Düsseldorf).
Am östlichen, landseitigen Kai des hinteren Beckens steht im vorderen, nördlichen Abschnitt eine Mühlenanlage, die zahlreiche Um- und Ergänzungsbauten erkennen lässt. Grundlage bildeten zwei um 1910 errichtete, voneinander unabhängige Großmühlen, die Firma Heinrich Auer („Aurora-Mühle“), zunächst in Nippes, sowie die Firma Leysieffer & Siepmann. Die in mehreren Bauabschnitten im Wesentlichen aus Stahlbeton errichteten Mühlen mit Geschoss- und Silobereichen wurden nach erheblichen Kriegszerstörungen bestandsnutzend erneuert und später miteinander verbunden (Architekt: Theodor Kelter). Die Mühlentechnik und innere Organisation wurden regelmäßig modernisiert und neustrukturiert. Während die Mühle zum Wasser und damit auch zur Kölner Innenstadt hin einen flächigen, geschlossenen, nach Norden ansteigenden Baukörper bildet, ist die Landseite durch rechtwinkelig dazu stehende Silogruppen unterschiedlichen Alters und entsprechende Verladeanlagen charakterisiert. Straßenseitig sind bzw. waren Verwaltungsgebäude vorgelagert.
Hafenseitig vor der Ellmühle finden sich zwei Getreide-Sauganlagen. Die südliche stammt im Kern noch von 1910, beide wurden 1971–72 erneuert.
Die Mühle wurde zwischenzeitlich durch die Gesellschaft „moderne stadt“ erworben und soll nach Verlagerung des Betriebs Teil des städtebaulichen Entwicklungsprojektes Deutzer Hafen mit Wohn- und Gewerbenutzung werden.
(Walter Buschmann / Matthias Hennies / Alexander Kierdorf, Institut. Industrie-Kultur-Geschichte-Landschaft, 2018)
Nachtrag: „Deutzer Hafen Köln“ - Konversion der Industriebrache
Das Gebiet der Industriebrache soll ab 2023 zum Stadtquartier „Deutzer Hafen Köln“ entwickelt werden. Den Kern des Konversionsprojekts der Stadtentwicklungsgesellschaft moderne stadt GmbH bilden dabei die Gebäude und Getreidesilos der früheren Ellmühle. Ziel ist es, auf einer Fläche von 37,7 Hektar ein einzigartiges Stadtquartier „Deutzer Hafen Köln“ in attraktiver Lage am Rhein und mit Blick auf den Dom zu schaffen:
„Ein gemischt genutztes Quartier und eine vielfältige Nachbarschaft, ein Ort mit unverwechselbaren, gut proportionierten Stadträumen von hoher ästhetischer Qualität und attraktiven, nutzerfreundlichen Freiräumen.“
Entstehen sollen dabei etwa 3.000 neue Wohnungen für 6.900 Bewohner, ferner rund 6.000 neue Arbeitsplätze sowie Kitas, eine Grundschule, Gastronomie, Kultur- und Freizeitangebote auf einer Brutto-Grundfläche von insgesamt rund 560.000 m2. Im Süden des Deutzer Hafen soll beginnend mit der Vermarktung ab 2023 ein gewerbliches Baufeld mit einem Gewerberiegel entstehen, der durch seine schallschützende Lage zur Kölner Südbrücke hin die spätere Wohnbebauung erst möglich machen soll (www.modernestadt.de).
(Franz-Josef Knöchel, LVR-Redaktion KuLaDig, 2022)
Hinweis
Das Objekt „Deutzer Hafen“ ist wertgebendes Merkmal des historischen Kulturlandschaftsbereiches Deutz, Mülheim (Kulturlandschaftsbereich Regionalplan Köln 353).
Internet
www.modernestadt.de: Deutzer Hafen (abgerufen 29.11.2022)