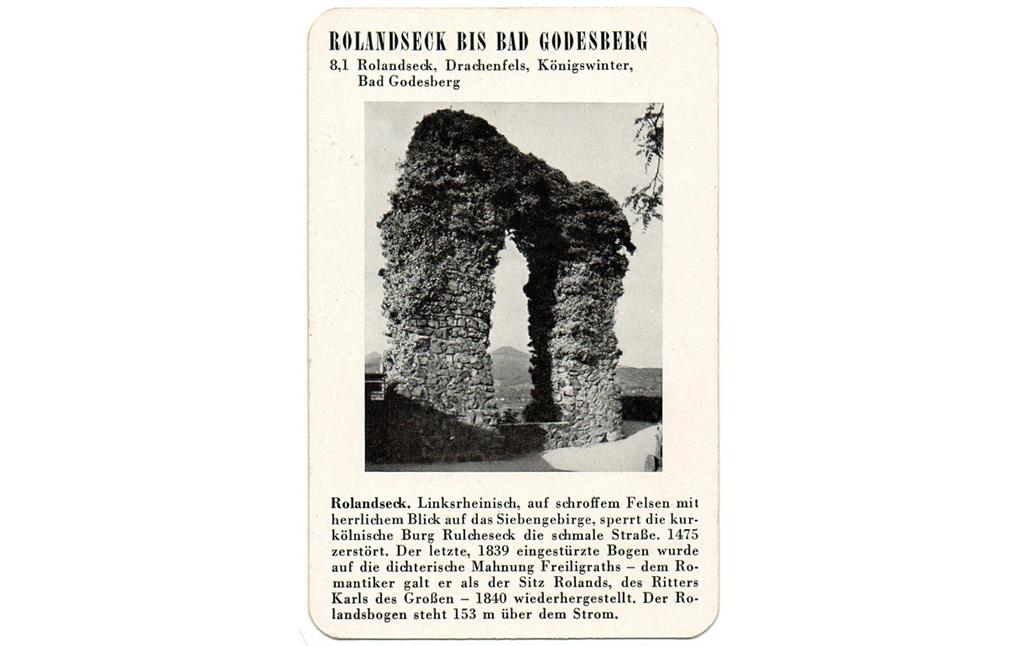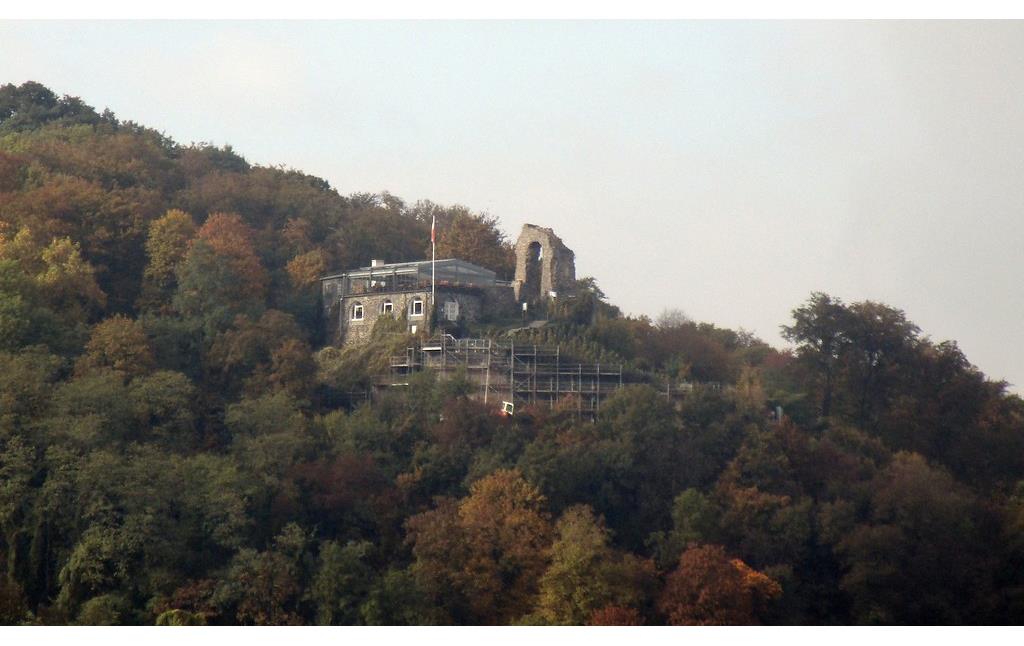1468 wurde die Burg als Gefängnis genutzt. 1475, während des „Burgundischen Kriegs“ explodierte der Pulvervorrat und zerstörte die Burg. Nach der Wiedererrichtung bestand die Burg bis zum 30-Jährigen Krieg (1618). Quellen berichten von einer Nutzung der Ruine als Steinbruch seit 1619, mit den Steinen soll die Südspitze der Insel Nonnenwerth gegen Abtragung abgesichert worden sein.
1640 ordnete der Kurfürst an die Burg Rolandseck und die Burg Drachenfels zu sprengen. Beide Burgen hatten ihren militärischen Funktion verloren und sollten keinen Unterschlupf für „Raubgesinde“ bieten.
Der Siegburger Abt Kuno I. erhielt vom Kölner Erzbischof die Erlaubnis ein Frauenkloster auf Nonnenwerth zu errichten. Die Stiftsurkunde ist auf den 01.08.1126 datiert. Die ersten Nonnen waren Benediktinerinnen. Das Kloster wurde wiederholt Opfer von Plünderungen. Im „Burgundischen Krieg“ wurde das Kloster zerstört und bis 1480 wieder aufgebaut. Im 30-Jährigen Krieg wurde die Insel von holländischen Truppen attackiert und schließlich 1632 von Schweden eingenommen und zerstört. 1650 wurde das Kloster wieder in Betrieb genommen. Bereits 1679 litt es unter den Raubzügen König Ludwig XIV. und wurde erneut zerstört. Hundert Jahre später brannte das Kloster 1773 nieder und wurde 1775 durch den Kurfürsten wieder in Stand gesetzt.
Mit der Eroberung durch die Franzosen 1802 droht dem Kloster die Auflösung. Jedoch erhielten die Nonnen die Erlaubnis es bis zu ihrem „Aussterben“ zu bleiben. 1815 übernahmen die Preußen das Gebiet von den Franzosen und ließen 1820 das Klosters räumen. Die letzten sechs Nonnen verließen die Insel. In der Folge wurde die Insel versteigert und vom neuen Besitzer 1822 zur Gaststätte umgebaut. Ausbleibender wirtschaftlicher Erfolg führte zum Verkauf und neuen Besitzern. Es entstand 1855 ein Ursulinenkonvent mit angeschlossener Mädchenschule. 1851 wurde es in ein Franziskanerinnenkloster umgewandelt. Im Ersten Weltkrieg diente Nonnenwerth als Lazarett und während der Zeit des Nationalsozialismus wurde die Schule zwischen 1941 und 1945 geschlossen und als Ausweichkrankenhaus der Universitätsklinik Köln genutzt, nachdem die schwere Bombardierung der Stadt 1943 begonnen hatte. Das Kloster und die Schule bestehen bis heute.
Ein Grund für die Entstehung des Orts Rolandswerth ist an diesem eher ungünstigem Ort schwer zu finden, jedoch befand sich hier bereits zu Zeiten der Römer eine Verbindungsstraße entlang des Rheins. Es ist durchaus denkbar das an dem Ort, an dem sich die Burg Rolandseck befindet, zu dieser Zeit ein Kastell stand, welches die Keimzelle der Ortsentwicklung gewesen sein könnte, wie bei den Städten Remagen, Andernach und Koblenz. Für diese Theorie gibt es keine eindeutigen Belege. Die Straßenführung entlang des Rheins war noch bis in das 19. Jahrhundert schwierig, denn die Straße entlang des Rheins war, entlang der steilen Felsen zwischen Unkelbach und Remagen, oft von Hochwasser betroffen und konnte nicht genutzt werden. Erst 1817 wurde die Straße hochwassersicher ausgebaut. So kann davon ausgegangen werden, dass diese Passage zuvor regelmäßig über die in Mehlem abzweigende Römerstraße nach Trier umgangen werden musste.
Es ist durchaus denkbar, dass die Siedlung sich erst mit der Errichtung der Burg und des Klosters auf der Insel ergab. So hätten die Handwerker und Fährleute wegen Arbeitgeber und Schutz einen Grund gehabt, sich dort anzusiedeln.
Noch auf der Tranchotkarte der alte Name des Orts Witgen, im Kataster der Ortsgemeinde Mehlem unter dem Namen „Commune de Rolandswerth“, 1816 bis 1847 auf den preußischen Karten Wittgen eingetragen. 1879 ist wieder Wittgen aber auch Rohlandswerth eingetragen.
Die ersten Gebäude des Ortes waren wohl die von einem Bürger Walbert aus Köln gestiftete Kapelle und das Hospital, die sich 1148 im Bereich der heutigen Fährläden befunden haben. Ein Ort wird erstmalig im Zusammenhang mit Zahlungen für einen Feldzug des Kaisers gegen die „Ketzer“ in Böhmen vom Erzbischof Dietrich II. am 1. März 1422 erwähnt. Dies könnte als die erste Erwähnung von Rolandswerth noch unter anderem Namen sein. Am 15. März 1631 kam es zu einer Erwähnung des Orts Veitgen im Zusammenhang mit einer Hexenverbrennung im Kirchenbuch von Mehlem. 1671 wurden Besitztümer des Klosters Altenberg im Gebiet des Orts Werth beschrieben. Dann wurde der Ort erst wieder in Jahre 1792 erwähnt, als der Amtsverwalter um Erlaubnis bittet, die Herberge für Kranke und Bettler in eine Schule umzuwandeln. Es folgt 1795 die französische Zeit und damit die Spaltung von Mehlem und das Ende des Kurfürstentum Köln.
1817 war Rolandswerth Teil der preußischen Rheinprovinz und zählte 266 Einwohner, 53 Häuser und 86 Morgen, also 21,5 Hektar, Weinberge. Nun folgte der bereits erwähnte Chausseebau, dem das Krankenhaus und die Kapelle weichen müssen.
Auch in Rolandseck profitierte man vom Tourismus, der seine Begründung sowohl in der Anziehungskraft der Heilbäder an Ahr und Rhein als auch durch das aufkommenden Interesse an der Schönheit der Natur im romantischen Rheintal hatte. Die ersten Reisenden waren Britten, später kamen dann verstärkt auch Gäste aus anderen Teilen von Deutschland an den Rhein. Wohlhabende aus den nahe gelegenen Städten errichteten dort Sommerresidenzen am Rheinufer, die noch heute bestehen.
Die Anbindung an das Schienennetz verstärkte die Beliebtheit des Gebiets, da es nun leichter und schneller zu erreichen war. Mit dem Tourismus begann auch der Prozess der auch schon in Bad Bodendorf zu beobachten war. Die Landwirtschaft, also auch der Weinbau wurde uninteressant, die Anbauflächen kleiner und mit dem Aufkommen der Reblaus verschwand auch hier der Weinbau.
(Jan Hansen, Universität Koblenz-Landau, 2014)