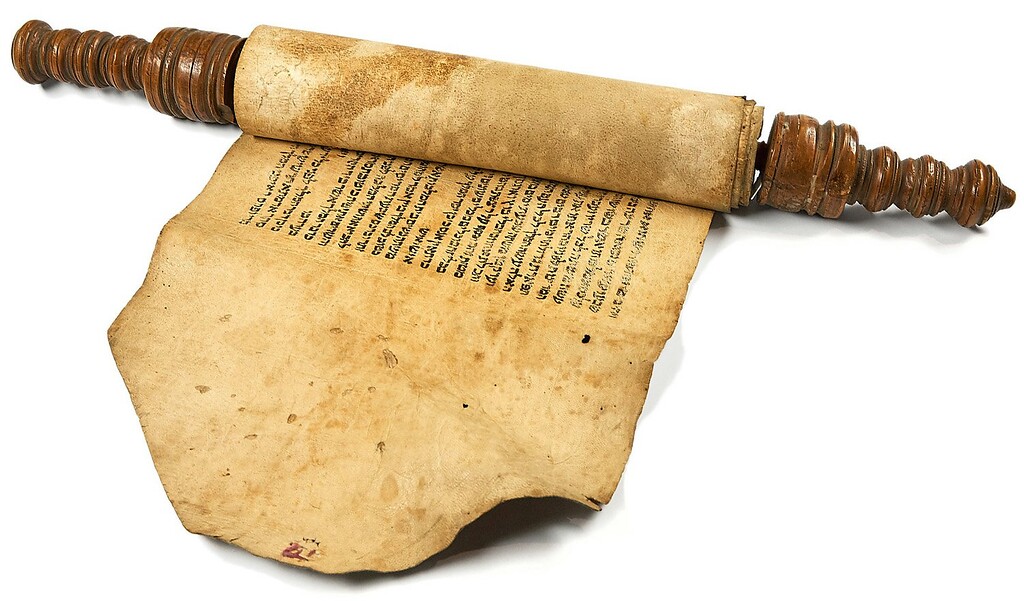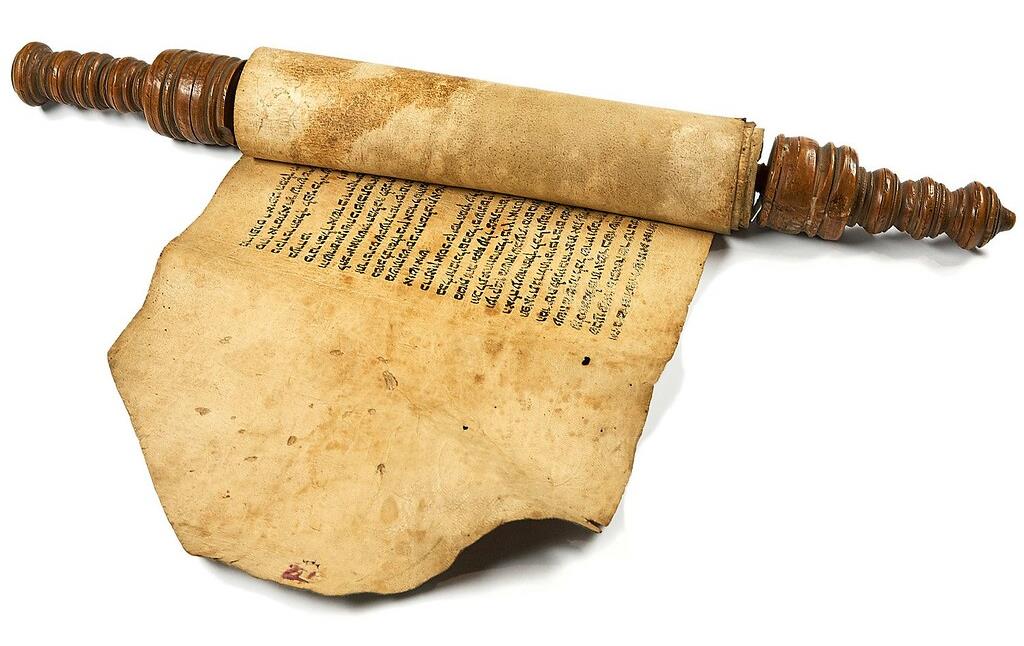Seit dem 18. Jahrhundert sind Nachrichten über eine kontinuierliche jüdische Besiedlung in Wesseling überliefert. 1806 lebten in der Bürgermeisterei Hersel (inklusive Wesseling) 63 Juden. In der napoleonischen Zeit wurde der Synagogenverband Hersel gegründet, der die Juden in Hersel, Widdig, Rheindorf und Wesseling umfasste. 1855 wurde die Synagogengemeinde Wesseling mit den Spezialgemeinden Wesseling, Hersel und Bornheim konstituiert. 1930 trennten sich Hersel und Wesseling von Bornheim. 1932 waren Hersel (7 Personen) und Widdig (9) angeschlossen.
Die Wesselinger Juden lebten vom Handwerk und Handel; einige waren als Viehhändler tätig. Gesellschaftlich waren sie überwiegend ins kleinstädtische Leben integriert (www.jüdische-gemeinden.de). Der heute noch erhaltene jüdische Friedhof wird erstmals 1783 erwähnt.
Gemeindegröße um 1815: o. A., um 1880: 92 (1885), 1932: 61, 2006: - (nach Reuter 2007).
Weitere Angaben finden sich bei Pracht (1997) mit 1720: 2 jüdische Familien, um 1795: 8 jüdische Familien, 1855: 84 Juden (sowie nach anderer Angabe 99), um 1860: ca. 90 (ca. 2 % der Bevölkerung), 1885: 92, 1923: 73, 1930: 120 (gesamte Kultusgemeinde), 1932/33: 61, 1938: ca. 40 und Juli 1940: keine.
Synagoge
In Wesseling wurde 1822 (oder 1850) eine Synagoge errichtet, die 1938 in Brand gesetzt und völlig zerstört wurde (Reuter 2007).
Eine Synagoge in Wesseling wurde erstmals 1822 erwähnt; sie diente zeitweise auch als Elementarschule. Das bescheidene, völlig unauffällige Gebäude befand sich am Markt 3 und bot knapp 40 Männern Platz; überdies verfügte es über eine kleine Frauenempore (de.wikipedia.org).
Zu der Zerstörung des Gotteshauses im Zuge der Novemberpogrome von 1938 berichtet www.jüdische-gemeinden.de, dass SA-Mitglieder das jüdische Bethaus niederbrannten und dass auch die in jüdischem Besitz befindlichen Nachbarhäuser Opfer der Flammen wurden. Wie an vielen anderen Orten auch, beschränkte sich die Feuerwehr einzig darauf, vom Feuer bedrohte Gebäude nicht-jüdischer Besitzer zu schützen. Nachfolgend sei dann die Ruine der Synagoge abgetragen worden und an der Stelle wurde während des Krieges ein Bunker errichtet.
Ferner wurden auch die Häuser jüdischer Bürger in der Nordstraße und der Langgasse demoliert, wonach viele Juden die Stadt verließen: „Nach den Gewalttaten des November 1938 verließen die restlichen Juden ihre Heimatstadt Wesseling; die meisten brachte man in ‚Judenhäuser' nach Köln.
Im September 1940 verstarb die letzte in Wesseling noch lebende Jüdin. Die meisten Wesselinger Juden, die ab 1941 von anderswo deportiert wurden, kamen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern ums Leben. Nur fünf von ihnen sollen das Kriegsende erlebt haben.“ (www.jüdische-gemeinden.de)
Gedenken und Erinnern
In der Nachkriegszeit wurde auf dem jüdischen Friedhof ein Gedenkstein zur mahnenden Erinnerung an die Ereignisse während der NS-Herrschaft und des Krieges errichtet.
Der Verein für Orts- und Heimatkunde initiierte 40 Jahre nach der Zerstörung der Synagoge die Errichtung eines Gedenksteins auf dem Platz vor dem früheren Standort der Synagoge. Dieser trägt die Inschrift:
„Seit dem 17.Jahrhundert gab es in Wesseling eine kleine Jüdische Gemeinde.
Ihre Synagoge stand seit 1850 am Markt 3. Sie wurde am 9.11.1938 in Brand gesteckt.
Die Mitglieder der Gemeinde kamen fast alle in nationalsozialistischen Konzentrationslagern ums Leben.
Wir gedenken unserer jüdischen Mitbürger. Wesseling, den 9.11.1978“
Ihre Synagoge stand seit 1850 am Markt 3. Sie wurde am 9.11.1938 in Brand gesteckt.
Die Mitglieder der Gemeinde kamen fast alle in nationalsozialistischen Konzentrationslagern ums Leben.
Wir gedenken unserer jüdischen Mitbürger. Wesseling, den 9.11.1978“
Seit dem Jahr 2000 erinnert jährlich ein von den lokalen Orts- und Heimatkundevereinen, den vor Ort ansässigen evangelischen, katholischen und griechisch-orthodoxen Kirchengemeinden und der Stadt veranstalteter „Gang des Gedenkens“ an die Geschehnisse in Wesseling.
Erstmals im Jahr 2014 wurden von dem Künstler Gunter Demnig (*1947) bislang 14 Stolpersteine zur Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit in Wesseling verlegt (Stand Mai 2025).
Objektgeometrie
Die einstige Lage der Synagoge lässt sich anhand der historischen Karten aus der Zeit ihres Bestehens nicht bestimmen. Sie ist hier daher mit einer symbolischen Geometrie im Bereich der heutigen Straßen Am Markt, Kölner Straße und Mühlengasse verzeichnet.
Das frühere Gotteshaus ist weder in der Topographischen Aufnahme der Rheinlande (1801-1828), noch in der zwischen 1836 und 1850 erarbeiteten Preußischen Uraufnahme oder in der Preußischen Neuaufnahme (1891-1912) wie auch den topographischen Karten TK 1936-1945 auszumachen.
Ergänzende Hinweise zu ihrer Lage sind daher willkommen!
(Franz-Josef Knöchel, Digitales Kulturerbe LVR, 2025)
Internet
zentralarchiv-juden.de: Wesseling (abgerufen 13.05.2025)
www.jüdische-gemeinden.de: Wesseling (abgerufen 13.05.2025)
www.evangelisch-wesseling.de: undatiertes und nicht weiter bezeichnetes Bild der Synagoge (abgerufen 13.05.2025)
de.wikipedia.org: Wesseling (abgerufen 13.05.2025)
de.wikipedia.org: Liste der Stolpersteine in Wesseling (abgerufen 13.05.2025)