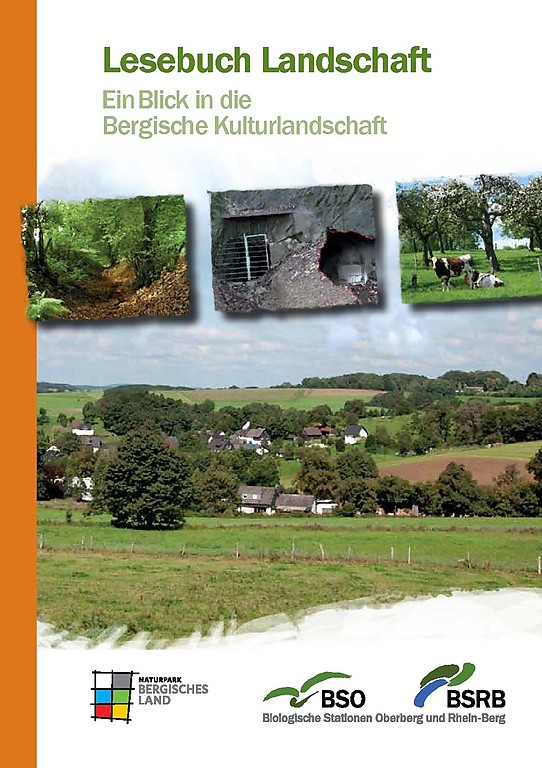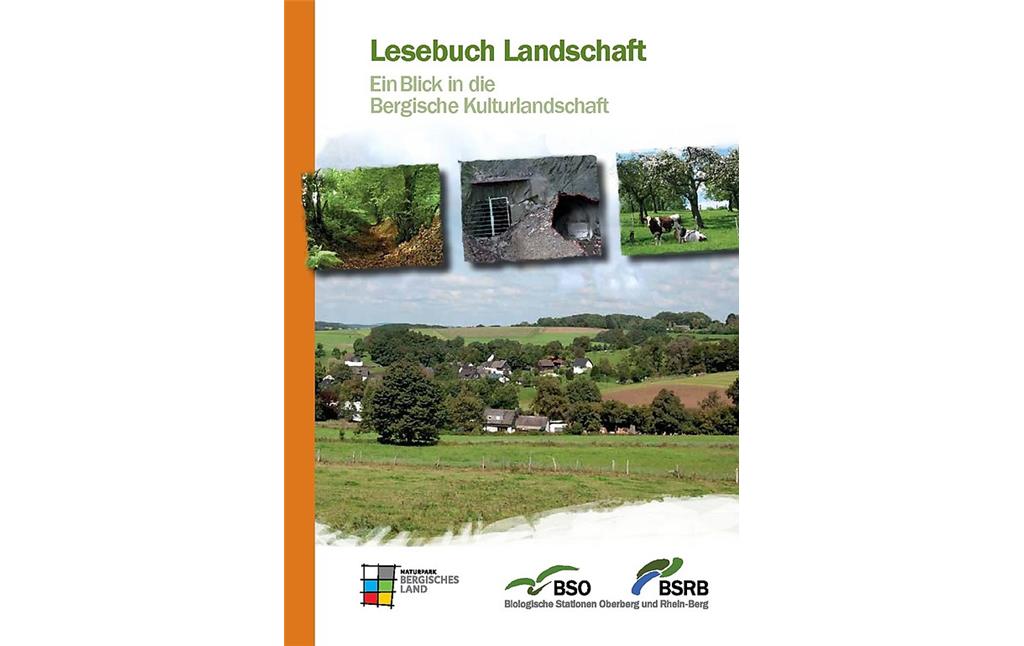Innerhalb der historischen Kulturlandschaft waren Hohlwege ein verbreitetes Phänomen. Mit der Einführung motorisierter Fahrzeuge und Landmaschinen sowie der Asphaltierung der Wege wurde ihr Vertiefungsprozess unterbrochen. Seitdem sind Hohlwege verkehrsgeschichtliche Relikte mit hohem Zeugniswert. Hohlwege sind aber nicht nur von historischer, sondern auch von ökologischer Bedeutung. Wenn sie nicht in einem Wald liegen, sind ihre Ränder oft heckenartig mit Sträuchern und Bäumen bewachsen. Dort und in den Hohlräumen der strukturreichen Seitenböschungen finden viele Lebewesen Unterschlupf, darunter zum Beispiel auch überwinternde Erdkröten. Zudem entsteht im Schutz der Seitenwände ein sehr spezielles Kleinklima, welches von Wärme, Trockenheit und einem fast beständig wehenden leichten Wind geprägt ist. Ein derartiges Klima ist sonst nur in den südosteuropäischen Steppengebieten zu finden. So wird der Hohlweg zu einer Heimat für viele seltene Tiere und Pflanzen: Wildbienen und -wespen bauen hier gerne ihre Bruthöhlen, Eidechsen sonnen sich, Dachse bringen ihre Jungen zur Welt, und mehrere Dutzend Vogel- und Schmetterlingsarten finden hier ein Zuhause.
Die Hohlwege der Zeitstraße sind besonders am Anstieg von Forst zum Immerkopf zu finden. Unter ihnen sind alle Größen vertreten, vom simplen Fußweg über den Saumpfad bis zu tief in den Boden geprägten, breiten Karrenspuren. Man findet hier ein Bündel aus mindestens zwölf verschiedenen Hohlwegen.
Die Zeitstraße verlief von der Eifel über Bonn, Siegburg und Much nach Drabenderhöhe. Dort kreuzte sie die von Köln nach Siegen verlaufende Brüderstraße und führte über die hohe Warte, Ründeroth, Marienheide, Rönsahl, Halver und Hagen nach Dortmund, wo sie auf den Hellweg traf.
Im Abschnitt zwischen Drabenderhöhe und Hohe Warte kreuzt der Weg der Zeitstraße ihre heutige Nachfolgerin, die Autostraße Drabenderhöhe-Weiershagen, die vormalige B 56. Von dieser aus führt der alte Waldweg am Hipperichsiefen entlang in Richtung Kaltenbach, wo man auf Spuren früherer Bergbautätigkeit stößt. Die Erzvorkommen in diesem Teil des früheren Herzogtums Berg erstreckten sich über die Grenze in das Homburger Land. Das dortige Zentrum des Bergbaus war die Ortschaft Forst.
(Biologische Station Oberberg, 2013. Erstellt im Rahmen des Projektes „Hecke, Hohlweg, Heimat – Kulturlandschaftsvermittlung analog und digital“. Ein Projekt im Rahmen des LVR Netzwerks Umwelt)