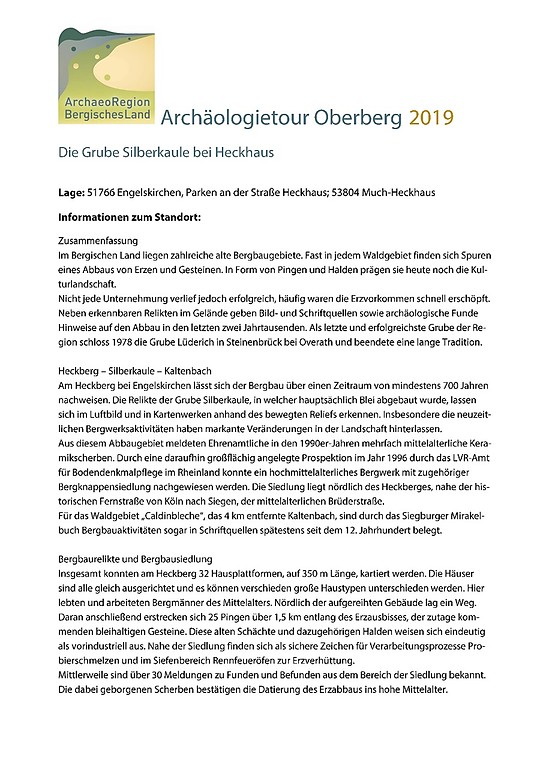Aus diesem Abbaugebiet meldeten ehrenamtliche Mitarbeiter der Bodendenkmalpflege in den 1990er-Jahren mehrfach mittelalterliche Keramikscherben. Durch eine daraufhin großflächig angelegte Prospektion im Jahr 1996 durch das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland konnte ein hochmittelalterliches Bergwerk mit zugehöriger Bergknappensiedlung nachgewiesen werden. Die Siedlung liegt nördlich des Heckberges, nahe der historischen Fernstraße von Köln nach Siegen, der mittelalterlichen Brüderstraße.
Obertägige Baulichkeiten der Bleierzgrube sind nicht erhalten. Im Bereich der Bachgabelung von Heckbach und Heckseifen treten an der Oberseite manganhaltige Grubenwasser aus. In diesem Bereich befinden sich die Reste des „Tiefen Stollens“, dessen Verlauf durch einen ca. 30 Meter langen Verbruch im Gelände sichtbar ist. Der hier nach Südsüdosten ansetzende Stollen verläuft auf die umfangreichen Bergwerkhalden zu und kann an der Oberfläche durch die Trichter der Lichtlöcher verfolgt werden.
Den modernen Produktionsbereich der Bleierzgrube dokumentieren Halden und Aufschüttungsflächen. Die trichterförmige Vertiefung bezeugt den Standort eines alten Förderschachtes. Östlich dieser Halden erstreckt sich ein umfangreiches Pingenfeld, das seine Fortsetzung an der Südseite findet und eine Länge von ca. 900 Metern erreicht. Ingesamt konnten mehr als 80 Einzel- und Doppelpingen kartiert werden. Darüber hinaus finden sich im Gelände mehrere Meilerplätze, die im direkten Zusammenhang mit dem Bergbaugebiet stehen dürften. Eine weitere große Schachtpinge liegt westlich des Haldenbereiches.
Die zahlreichen und in ihrem Erhaltungszustand sehr unterschiedlichen Pingen weisen auf ein hohes Alter des Bergbaus hin. Bei diesem Schachtbergbau teuften die Bergleute zwei im Durchmesser und Abstand 1,30 Metern breite Reifenschächte (Ausbau mit Zweigen aus biegsamem Holz) bis zum Grundwasserspiegel ab und verstärkten diese mit jungen, biegsamen Eichenstämmen, die dem Gebirgsdruck am besten widerstanden. Die parallele Führung diente der Erzielung einer besseren Wetterzirkulation und einer rationelleren Förderung. Im 16./17. Jahrhundert gingen die Bergleute daran, mit Hilfe eines „Tiefen Stollens“ das Grubenwasserproblem zu lösen. Der Stollen bei Heckbach erreichte eine Teufe von 60 Metern und ist 308 Meter lang.
Oberhalb dieser Pingen fand man Podien, die als Grundflächen von Häusern unterschiedlicher Größe dienten. Insgesamt konnten am Heckberg 32 Hausplattformen, auf 350 Metern Länge, kartiert werden. Die Häuser sind alle gleich ausgerichtet und es können verschieden große Haustypen unterschieden werden. Hier lebten und arbeiteten Bergmänner des Mittelalters. Nördlich der aufgereihten Gebäude lag ein Weg. Daran anschließend erstrecken sich 25 Pingen über 1,5 Kilometer entlang des Erzausbisses, der zutage kommenden bleihaltigen Gesteine. Diese alten Schächte und dazugehörigen Halden weisen sich eindeutig als vorindustriell aus. Nahe der Siedlung finden sich als sichere Zeichen für Verarbeitungsprozesse Probierschmelzen und im Siefenbereich Rennfeueröfen zur Erzverhüttung. Mittlerweile sind zahlreiche Meldungen zu Funden und Befunden aus dem Bereich der Siedlung bekannt. Die dabei geborgenen Scherben bestätigen die Datierung des Erzabbaus ins hohe Mittelalter.
Das neuzeitliche Bergwerk Silberkaule war durch den „Tiefen Stollen“, die drei Schächte Mals, Baur und Carl Paula sowie fünf Tiefbausohlen aufgeschlossen. Die bauwürdige Ganglänge betrug maximal 340 Meter und nahm bis zur tiefsten Sohle auf 40 Meter Länge ab.
Geschichte und historische Quellen
Hinweise auf den alten Bergbau geben die Situationskarte und der Verleihungsriss von 1837 bzw. 1854. Eingezeichnet sind der „Tiefe Stollen“ mit den entsprechenden Lichtlöchern (Luftlöcher) sowie die umfangreichen Pingenfelder. Darstellungen der Grubengebäude sind auf der Fortschreibung der Urkarte von 1828 verzeichnet.
In älteren Publikationen wird darauf hingewiesen, dass der Bergbau im Bereich der Grube Silberkaule bereits im Spätmittelalter eine erste Blüte erreichte. Während des 30-jährigen Krieges 1618 bis 1648 wurde der Bergbau eingestellt. In den Bergwerksakten des 19. Jahrhunderts wurde dazu auf einen Betrieb „vor Anwendung des Pulvers“ verwiesen (nach Kinne 1884).
Eine erste belegte Mutung (Antrag eines bergbauwilligen Unternehmers bei einer Bergbaubehörde auf Genehmigung zum Bergbau) erfolgte am 16. August 1824, doch fiel diese schon bald wieder ins Bergfreie (war erfolglos). Von 1833 bis 1844 ist der Bergbau wiederum belegt. Abgebaut wurden Bleiglanz und Zinkblende. Die Produktion betrug zwischen 1826 und 1882 18.614 Tonnen Blei- und 232 Tonnen Zinkerze.
Um 1870/72 wird eine Dampfmaschine für die Aufbereitung der gewonnen Erze angeschafft, wenige Jahre später folgte die Einrichtung für eine Seilfahrt. In den 1920er Jahren erfolgte der Konkurs und die Stilllegung.
(LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, 2019)
Hinweis
Die namengebende Siedlung Heckhaus liegt südlich des Grubenfeldes bereits in der Gemeinde Much.
Die Silberkaule ist wertgebendes Merkmal des Kulturlandschaftsbereiches Heckberger Wald / Kaltenbach (Regionalplan Köln 416).
Die Bleierzgrube Silberkaule ist eingetragenes Bodendenkmal (Gemeinde Engelskirchen, lfd. Nr. 5; LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, lfd. Nr. GM 63) und war Station der Archäologietour Oberberg 2019 (siehe Infoblatt in der Medienleiste).
Quelle
Oberbergamt Dortmund, Bergrechtsamtsakte Grube Silberkaule 1837
Internet
www.heimatverein-drabenderhoehe.de: Silberkaule (Abgerufen: 11.9.2019)
de.wikipedia.org: Grube Silberkaule (Abgerufen: 11.9.2019)