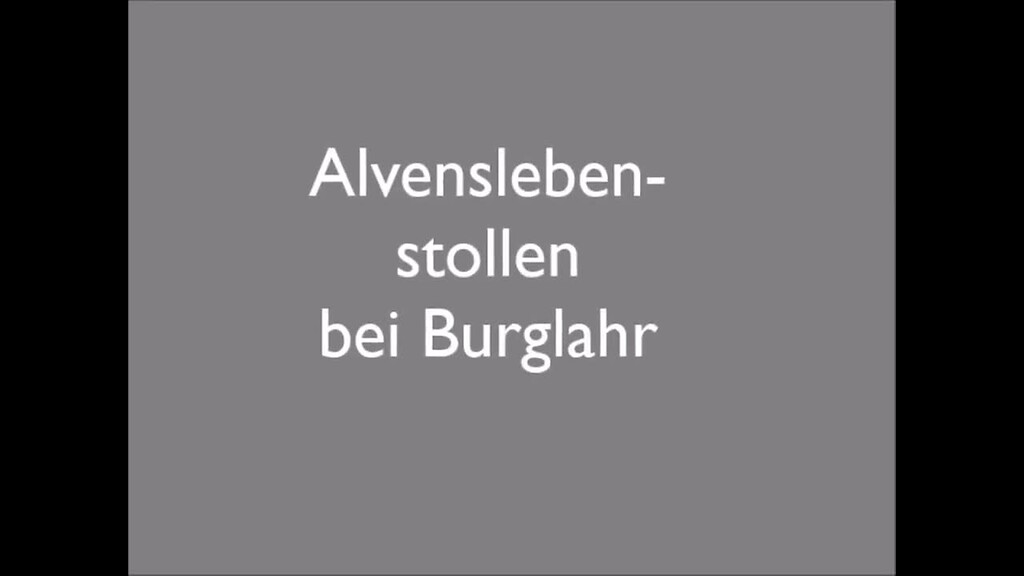Entstehung des Alvensleben-Stollens
In den 1830er Jahren genoss die nahe gelegene Grube Louise (auch Louisenstollen) ein hohes Ansehen. Dieses beruhte auf der Reinheit der durch sie geförderten Eisenerze und fand zugleich Ausdruck in den umfangreichen Fördermengen. Um das Jahr 1825 jedoch zeichnete sich ein Ende der Abbauarbeiten durch Erschöpfung des Erzganges ab. Dies lag auch darin begründet, dass die Grube Louise nur wenige Meter höher lag als der nahe gelegene Lahrbach. Daher bestand die Gefahr von Überflutungen der Stollen bei einem Ausbau der Stollen in tiefere Regionen. Zur damaligen Zeit war die (Pump-)Technik noch nicht genug ausgereift, um an diesem Standort tiefer zu graben. Daher entschied man sich dazu, einen Stollen auf der gegenüberliegenden Seite des Harzbergs zu erschließen. Benannt wurde der neue Stollen nach Albrecht Graf von Alvensleben (1794-1858). Dieser war als preußischer Finanzminister ab dem Jahr 1836 auch für das Ressort Bergbau verantwortlich. Zu vermerken ist, dass bei Verwendbarkeit einer geeigneten Technik zum benötigten und beschriebenen Zeitpunkt in der Grube Louise, der Alvensleben-Stollen nie gegraben worden wäre.
Der Stollen
Der Standort des Alvensleben-Stollens erscheint nach heutigen Betrachtungen nicht vollkommen ideal gewählt zu sein. Zum einen, da sich ein Stollenbeginn flussaufwärts (Wied) als insgesamt kürzer erwiesen hätte. Zum anderen, da laut alten Aufzeichnungen des Oberbergamts Bonn vom 12.11.1843 der Verlauf der Wied zu diesem Zeitpunkt viel näher am heutigen Stolleneingang gelegen war und somit die eigentlich ungünstige Lage bestärkte. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Orientierung der Vermessungen sich unter damaligen Umständen bei der Ausrichtung an der Burg Lahr als hilfreich erwiesen.
Die Beschaffenheiten dieser Wied-Uferseite erlaubten einen Stollen, der um die 30,80 Meter tiefer angelegt war, als der bisherige Louisenstollen. Die Bauarbeiten des Alvensleben-Stollens begannen im Jahr 1835 und endeten nach 1.546 Meter Länge (Durchschnittlicher Vortrieb pro Tag: 14,6 Zentimeter) im Jahr 1864. 29 Jahre betrug demnach die Bauzeit. Durch diesen Bergstollen mit einem Gefälle von 1,5 Meter auf einer Stollenlänge von 1.000 Meter war die Arbeit im Bergwerk für eine ganze Generation gesichert.
Durch die später im Bergbau eingeführte Dampfmaschine war nun auch in der Grube Louise ein Abteufen (Erschließen von senkrechten Schächten) möglich. Im Jahre 1872 wurde der Gerlachschacht und im Jahre 1883 der Barbaraschacht abgeteuft. Den tiefsten Aufschluss bot der Barbaraschacht mit einem Tiefgang von bis zu 450 Metern. Der Alvensleben-Stollen wurde bis zum Jahr 1930 weiter als Wasserlösungsstollen betrieben. So wurde mittels Dinglerscher Wasserhaltungsmaschine das Grubenwasser aus den Tiefen der Schächte nur bis zu seinem Sohlenniveau angehoben.
Ende des Abbaus und heutige Nutzung
Im Laufe der 1950er Jahre wurde der Alvensleben-Stollen aufgegeben und teilweise zugeschüttet. Seit dem Jahr 1988 wurde durch eine private Initiative (u.a. ehemalige Bergleute) der Stollen wieder aufbereitet. Im Mai des Jahres 2000 wurde eine Betriebserlaubnis zur Nutzung als Besucherbergwerk durch das Bergamt in Koblenz freigegeben. Heute ist der Stollen die 14. Station des Erz-Wanderweges und gegen einen kleinen Obolus jeden dritten Samstag im Monat auf 400 Metern begehbar.
(Jan Grendel, Universität Koblenz-Landau, 2014)
Internet
burglahr.de: Alvenslebenstollen (abgerufen 11.08.2014)
www.vg-altenkirchen-flammersfeld.de: Alvenslebenstollen in Burglahr (abgerufen 29.06.2022)