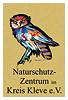
Die flache Niederrheinlandschaft ist nicht gerade bekannt für ihren Rohstoffreichtum. Mit den heutigen Transportmöglichkeiten ist das kein Problem mehr. Es macht keinen großen Unterschied, ob man in Bochum oder Emmerich wohnt. In früheren Zeiten mussten sich die Menschen aber mit dem bescheiden, was sie vor der Haustür hatten. Dieser Rohstoffknappheit begegnete man unter anderem mit den Kopfbäumen. Als Kopfbäume wurden Weiden, Eschen und Eichen genutzt. Ihre Äste wurden alle paar Jahre bis auf den Stamm heruntergeschnitten, so dass sich das eigentümliche Aussehen ergab. Der Abschnitt konnte für die verschiedensten Zwecke benutzt werden: Weiden für Korbflechterei oder Uferbefestigung, Eschenäste z. B. als Werkzeugstiele.
Kopfbäume bilden mit der Zeit Höhlungen aus, die einer Vielzahl von Tierarten als Lebensraum, Unterschlupf oder Nistplatz dienen. Besonders der Steinkauz ist als Höhlenbrüter auf das Vorhandensein von Kopfbäumen angewiesen. Die Menschen sind es nicht mehr. Spitzhackenstiele kann man heute leichter im Baumarkt kaufen als von einem Baum herunterzuschneiden. Auch Körbe sind durch Kunststoffwannen ersetzt worden und als Brennmaterial hat Holz übermächtige Konkurrenz bekommen. Der Schnitt der Kopfbäume ist daher nicht mehr wirtschaftlich motiviert sondern eine landschaftspflegerische Aufgabe, die dem Erhalt eines Kulturlandschaftselements sowie auch dem Naturschutz dienen. Kein Wunder, dass ihre Zahl abgenommen hat, denn werden sie nicht mehr geschnitten, zerstört das den Baum. Mit jedem Einzelnen geht dann ein kostbarer Lebensraum verloren, der Tieren vom Steinkauz bis zu spezialisierten Käferarten das Überleben ermöglicht hatte.
(mobile discovery GmbH, Johanna Dohle, erstellt in Kooperation mit dem Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. im Rahmen des Projektes „Verborgene Schätze inklusiv“. Ein Projekt des LVR-Netzwerks Landschaftliche Kulturpflege, 2016)





