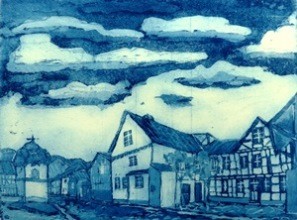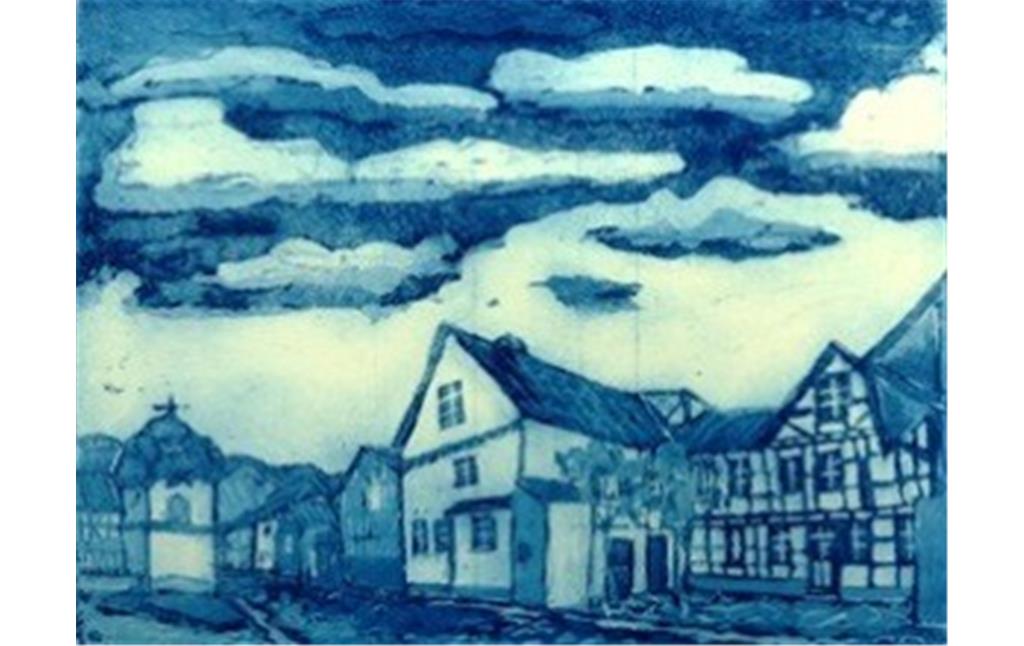Am Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bestand in Dernau eine Gemeinde; 1875 gehörten die Dernauer Juden zur Gemeinde Ahrweiler, dito 1932.
Gemeindegröße um 1815: 20 (1808), um 1880: 21 (1885), 1932: 14 / 13 (1925), 2006: –.
Bethaus / Synagoge: Eine Betstube wurde vermutlich Ende des 18. Jahrhunderts eingerichtet; wahrscheinlich wurde sie bis Mitte des 19. Jahrhunderts benutzt (vorstehende Angaben alle nach Reuter 2007).
(LVR-Redaktion KuLaDig, 2016)
Betstube / Synagoge
Die Betstube befand sich in der damaligen Dernauer Teichgasse, heute Hauptstraße, gegenüber des Matthias-Heiligenhaus. Das vor 1700 erbaute Stammhaus der Familie Heymann diente bis ins 19. Jahrhundert als Synagoge und Judenschule der jüdischen Gemeinde Dernau. Nach dem Einmarsch der Franzosen 1796 wurde die Synagoge auch von der jüdischen Gemeinde in Ahrweiler besucht. Einem Dokument von 1816 ist zu entnehmen, dass Jacob Heymann der Vorsteher der Dernauer Synagoge war. Bis 1844 wurde die Synagoge in Dernau von dessen jüdischen Gemeinde und denen der Nachbargemeinden genutzt. Später kam es zur Gründung einer Synagogengemeinschaft mit Ahrweiler und Heimersheim und auch jüngere Mitglieder der Familie Heymann besuchten von da an die Gemeinde in Ahrweiler. Das Gebäude der ehemaligen Synagoge in Dernau wurde 1896 an eine nichtjüdische Familie des Ortes verkauft.
Baubeschreibung
Der große Hof ist von drei Fachwerkbauten, die wahrscheinlich vor 1700 erbaut wurden, umgeben. Im obersten Stockwerk des westlichen Teils befand sich ein Betraum, der Platz für etwa zwanzig Personen bot. Der Raum war und ist heute noch mit einer sogenannten „Kölner Decke“ versehen (eine Konstruktion aus Deckenbalken und darüber liegenden Dielen, die vollständig von Putz überzogen ist). Daraus lässt sich das ungefähre Alter des Hauses ermitteln. Zudem ist dieses Bauelement meist in Häusern wohlhabender Familien verbaut worden. Neben dem ehemaligen Betraum befindet sich ein weiterer, kleiner Raum, der vermutlich Teil des Betraumes war und von den Frauen der jüdischen Gemeinde genutzt wurde. In einer Nische des Betraumes wurden vermutlich Gegenstände des jüdischen Kultes aufbewahrt.
Neben dem Eingang zum Gebetraum befand sich ein sogenanntes „Sälchen“ in dem Versammlungen stattfanden und Unterricht gehalten wurde.
Auf der Ostseite des Hofes befand sich ein Wasserbrunnen. Da das Haus an der damaligen tiefsten Stelle im Ort lag, war der Hauptkeller von jedem Hochwasser betroffen. Es ist anzunehmen, dass sich der Mikwe, die Stelle an der vor allem Frauen ein rituelles Bad nahmen, im Keller der Familie Heymann befand.
An der Ostseite und der Südseite des Hofes lagen die Scheunen und Stallungen. Das Gebäude verfügte über ein „Kutscherzimmer“ das von reisenden Geschäftsleuten genutzt werden konnte (Bertram 2015).
(Madeleine Weyand, Universität Bonn, 2016)
Internet
www.alemannia-judaica.de: Friedhof Dernau (abgerufen 28.11.2012)
de.wikipedia.org: Jüdischer Friedhof Dernau (abgerufen 23.11.2012)