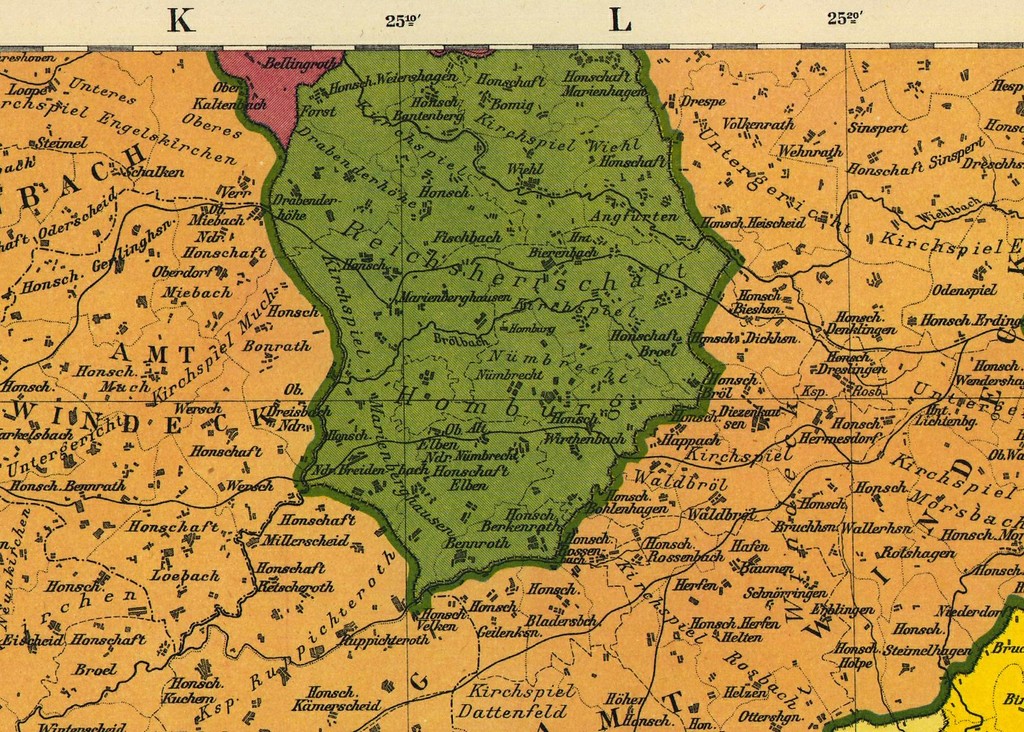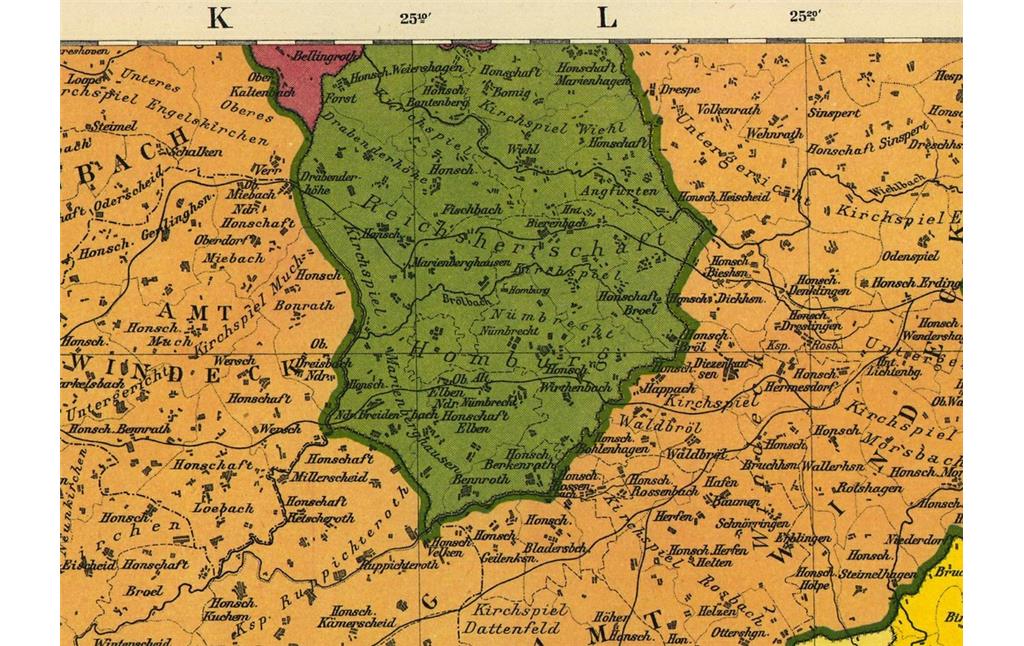Wo genau sich das Burghaus der Ritter von Deycenhusen / Diezenkausen befand, ist leider nicht bekannt. Die Ritter besaßen zwei Güter, neben dem in Diezenkausen auch ein weiteres im benachbarten Eichen (Waldbröl), welches bis ins 17. Jahrhundert ebenfalls den Namen Diezenkausen trug. Die Ritter von Deycenhusen dienten abwechselnd verschiedenen Herren. Mal standen sie im Dienst der Grafen auf Schloss Homburg, dann aber auch wieder im Dienst von deren Rivalen, dem Herzog von Berg auf Burg Windeck. Die Rittermühle am Standort „Zur Klus“ (Niederhof Waldbröl) gehörte einst ebenfalls zum Besitz derer von Diezenkausen. Dort starb der letzte Diezenkausener Ritter im Jahr 1625 kinderlos. Damit endete das ritterliche Besitztum. Im 18. Jahrhundert gingen die Höfe dann in Bauernbesitz über.
Heutzutage existieren in Diezenkausen noch zwanzig sehr gepflegte Fachwerkhäuser mit einem Alter von hundertfünfzig bis zweihundertfünfzig Jahren, in einem Fall wahrscheinlich sogar dreihundert Jahren. Neben den beiden ältesten Häusern in der Diezenkausener Straße 4 und im Erlenweg) sind die Häuser in der Ritter-Tilmann-Straße 2 und im Sperberweg mit ihren Türinschriften besonders sehenswert. In der Ritter-Tilmann-Straße 2 steht zudem das letzte alte, noch funktionstüchtige Backhaus des Dorfes. Insgesamt verfügt der Weiler über fünf erhaltenswerte Backhäuser. Hinter dem Haus Althoff befindet sich zudem die alte Dorflinde. Ferner sind zwei kleine Bauernschmieden zu sehen, in denen früher die Pferde beschlagen wurden.
Der Grundriss von Diezenkausen ist eindeutig nicht am Reißbrett entstanden, sondern historisch gewachsen. Durch die unregelmäßige Stellung der Häuser ergeben sich interessante Sichtbezüge. Aus der Urkatasteraufnahme aus dem Jahr 1830 ist zu ersehen, dass sich das Hauptwegenetz seit dem frühen 19. Jahrhundert kaum verändert hat. Auch die Parzellenstruktur hat trotz mehrerer Änderungen ihren Maßstab und ihr Grundmuster beibehalten und gilt deshalb als erhaltenswert.
Die im 19. Jahrhundert entstandenen vier Teiche, welche teilweise vor ein paar Jahren noch existierten, sind inzwischen ausgetrocknet und zu sumpfigen Mulden geworden.
(Biologische Station Oberberg, 2013. Erstellt im Rahmen des Projektes „Hecke, Hohlweg, Heimat – Kulturlandschaftsvermittlung analog und digital“. Ein Projekt im Rahmen des LVR-Netzwerks Umwelt.)