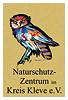
In der Kendel-Niederung bei Hülm ist ein ursprünglich weit verbreitetes und heute nur noch selten sichtbares Landschaftsmerkmal zu sehen: Eine besonders gut erhaltene Niederungsstruktur mit weiten Mäanderbögen und dem Nebeneinander von höher gelegenen Donken und feuchten Niederungen, den Kendeln. Sie sind Relikte der Eiszeit.
Die friedliche Idylle an der Kendel gibt auf den ersten Blick wenig von ihrem Ursprung preis und macht es schwer vorstellbar, dass hier einst wahre Urgewalten am Werk waren. Tatsächlich war die Landschaft hier während der Eiszeit alles andere als idyllisch. Ungebändigte Flusssysteme von Rhein und Maas lagerten enorme Mengen an Schotter und Kies ab, und Gletscher türmten nicht weit entfernt riesige Geröllmassen zu den heutigen Niederrheinischen Höhen auf. Nach der Eiszeit, in unserer jetzigen Wärmeperiode, gruben Schmelzwässer dann im Verlauf vieler 1000 Jahre stark geschlungene Rinnen und Senken in die Schotterterrassen.
Dieses Nebeneinander von höher gelegenen, trockeneren Terrassen – den Donken - und feuchten Niederungen – den Kendeln - hat sich bis heute erhalten. Die Morphologie des Geländes erklärt auch die charakteristische Kleinteiligkeit der hiesigen Landschaft. Denn die Menschen haben sich bei der Landnutzung daran orientiert. In den niedrig liegenden, feuchten Kendeln ließ sich kein Acker anlegen - auf den höher gelegenen Donken aber schon. Die Kendeln taugten dagegen gut als Wiesen- und Weideland. Und Siedlungen und Gehöfte entstanden meist an den Grenzlinien von Donk und Kendel – viele Orts- und Straßennamen wie die nahgelegene Gaesdonker Straße erzählen noch davon. Der kleine Bachlauf hier liegt in einer solchen Kendel und hat daher auch seinen Namen. Die an den Bach angrenzenden Kopfbäume sind typisch für die feuchte Niederung. Wenn man etwas weiter schaut, sieht man die höher gelegenen Ackerflächen. Die Höhenunterschiede sind hier mit ein bis zwei Meter für einen Betrachter kaum sichtbar. Aber die Wechsel zwischen feuchten Niederungen und höher gelegenen, trockenen Bereichen kann man in diesem Kendel- und Donkenland tatsächlich bemerken.
(mobile discovery GmbH / Peter Burggraaff / Kai-W. Boldt / Johanna Dohle, erstellt in Kooperation mit dem Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. im Rahemn des Projekt „Verborgene Schätze inklusiv“. Ein Projekt des LVR-Netzwerks Kulturlandschaft, 2017)



